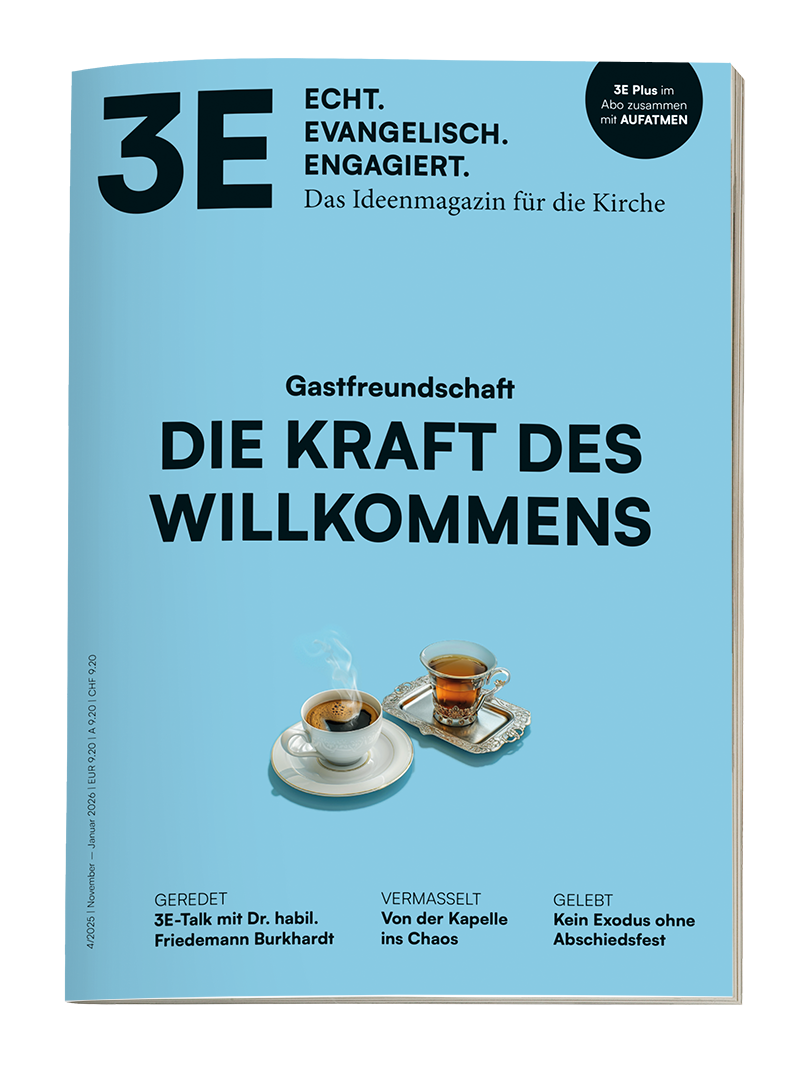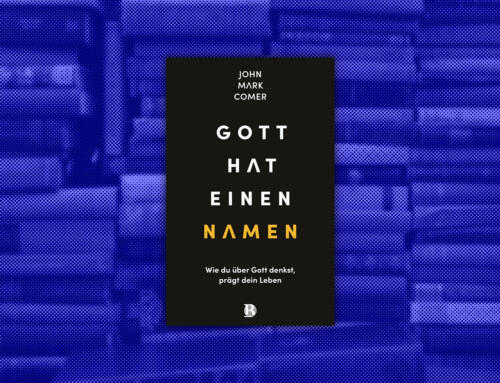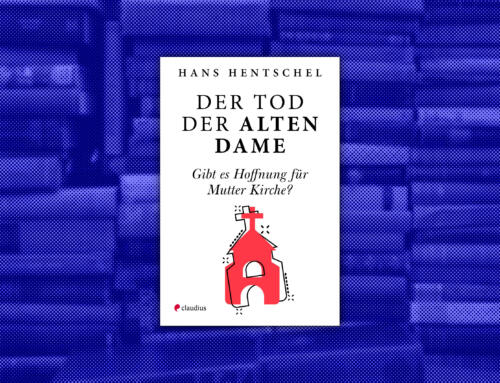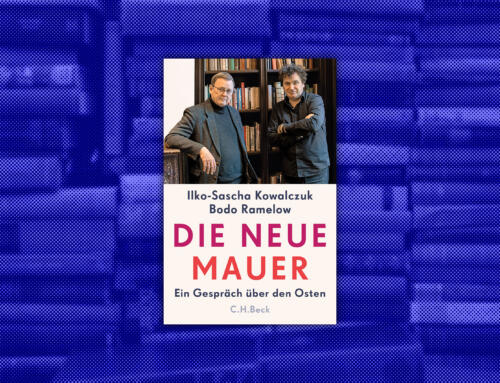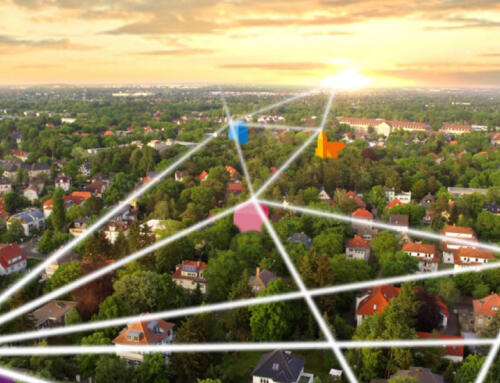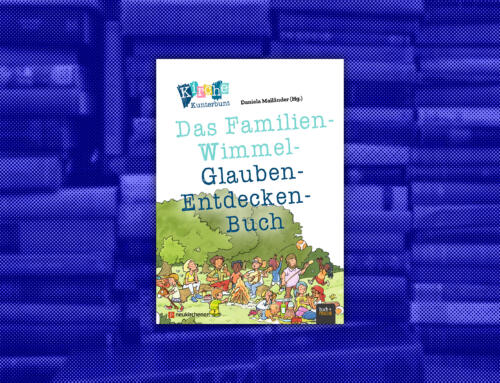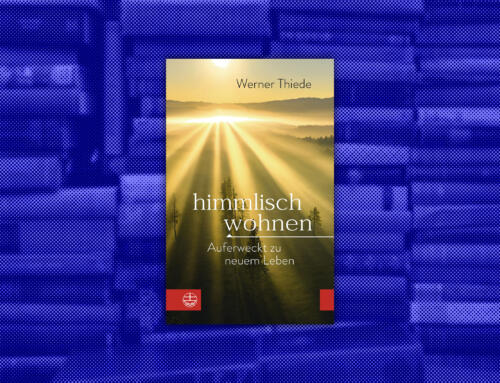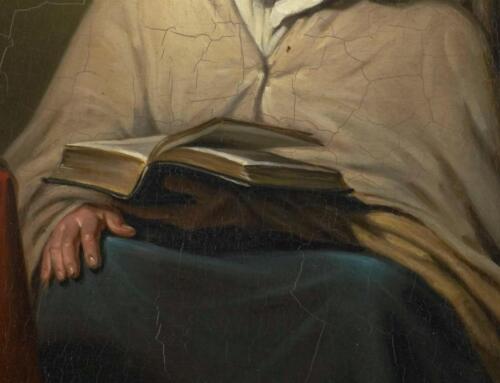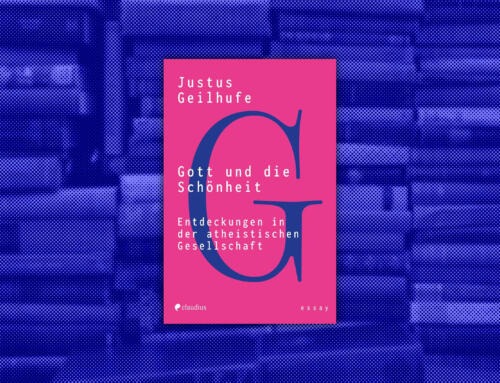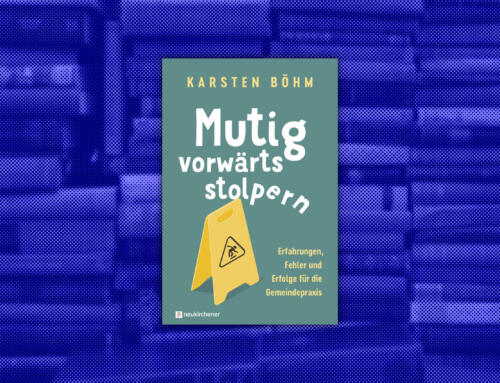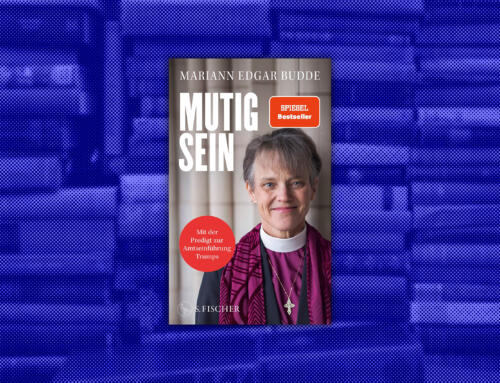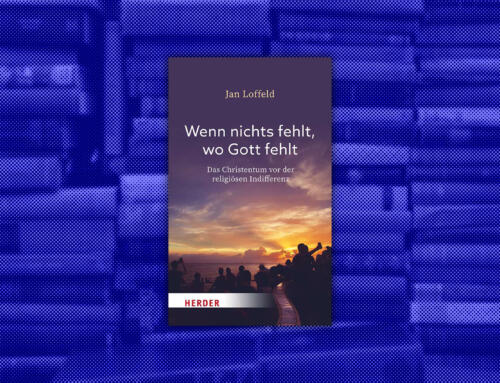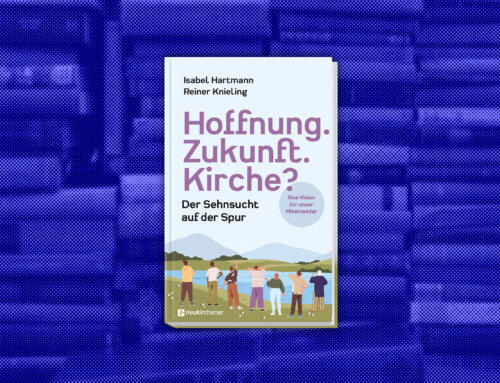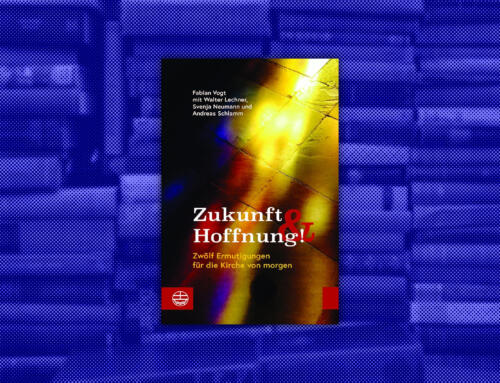Gott feiern. Regelmäßig und bunt.
Gott feiern. Regelmäßig und bunt.
VON Emilia Handke
Wie können mehr Menschen mehr Reich-Gottes-Erfahrungen machen? Indem wir Gottesdienste von ihrem Ziel her denken.
Im Jahr 2019 ist die sog. Kirchgangsstudie veröffentlicht worden. Sie wurde von der Liturgischen Konferenz der EKD in Auftrag gegeben, an ihr haben sich bundesweit mehr als 12.000 Menschen beteiligt. Kurz nach der Veröffentlichung erscheint auf dem Portal evangelisch.de ein Artikel dazu, der den Titel „Der langsame Abschied vom Sonntag“ trug. Diesen Artikel teilt Pfarrerin Kathrin Oxen am 7. August 2019 in der Gruppe „Predigtkultur“ auf Facebook. Darin wird der langjährige Vorsitzende der Liturgischen Konferenz Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck zitiert, der zwar als Vorsitzender der Liturgischen Konferenz an der Entstehung der Studie beteiligt war, sie aber nicht mitverfasst hat.
Den klassischen Gottesdienst nicht aufgeben
Er sagt: Auch wenn die Studie unmissverständlich zeige, dass der Sonntagsgottesdienst im Verhältnis zu Kasual- und Festtagsgottesdiensten verhältnismäßig wenig Resonanz erfahre, sei es fatal, beim Sonntagsgottesdienst ein Rückzugsgefecht anzutreten. Der Sonntagsgottesdienst sei so etwas wie der performative Kirchturm, die „Repräsentanz des Evangeliums in der Gesellschaft“. „Sonntags um zehn müssen die Glocken läuten, auch wenn ich gerade gemütlich beim Frühstück mein Ei aufschlage und nicht zum Gottesdienst gehe“, so Meyer-Blanck. Den agendarischen Gottesdienst für die Hochverbundenen und Hochengagierten müsse es weiterhin geben. Diese Hochverbundenen seien nach wie vor eine Kernzielgruppe und wirkten als Multiplikator*innen für Kirche.
Daraufhin entbrennt auf Facebook eine wilde Diskussion mit 116 Kommentaren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich zitiere stellvertretend die ersten drei: „Frank H.: Ich kann da Michael Meyer-Blanck nur zustimmen. Geben wir den Sonntag auf, geben wir unsere Mitte auf und lösen uns in eine individualistische Religionsgemeinschaft auf. Von ,Gemeinde‘ kann man dann, finde ich, nicht mehr sprechen.“ „Konrad C. (an) Frank H.: ,Sonntags-GD ist die Mitte der Gemeinde‘ – genau mein Humor“ „Sara B. (an) Frank H.: Dann viel Freude mit ,Wenn zwei oder drei … „beim Untergang zusehen“
Ich glaube fest an die Kraft einer Kasualisierung des Kirchenjahres.
Die Spannungspole sind damit benannt: „Gemeinde“ vs. individualisierte Religion, „Mitte“ vs. Rand, Hochverbundene vs. Unverbundene, Kontinuität vs. Abbruch bzw. noch drastischer „Untergang“. Die gewählte Semantik deutet an, dass für Frank H., Konrad C. und Sara B. in emotionaler Hinsicht etwas auf dem Spiel steht. Und das ist psychologisch betrachtet ja auch völlig verständlich.
Der eine Pol dieser Diskussion besitzt die Weisheit, dass nur weitergegeben werden kann und erkennbar bleibt, was eine klare Form besitzt. Der Sonntagsgottesdienst gliche dann einem kleinen Stundenkloster, in das man kommen und sich anschließen kann, wenn man Unterschlupf und Obdach sucht. Er ist eine wöchentliche geistliche Übung für kleine Mönche und Nonnen – so hat es Thomas Hirsch-Hüffell einmal pointiert. Überall ist ähnlich, was man vorfindet. Seine Bedeutung liegt in seiner Regelmäßigkeit – nichts anderes meint Michael Meyer-Blanck, wenn er von dessen symbolischer Qualität spricht: „Sonntags um zehn müssen die Glocken läuten, auch wenn ich gerade gemütlich beim Frühstück mein Ei aufschlage und nicht zum Gottesdienst gehe“ – so wurde er auf evangelisch.de zitiert.
Archivare der geistlichen Schätze
Er ist das gesellschaftlich garantierte geistliche Hintergrundrauschen, welches man selbst bei Bedarf lauter drehen kann – die britische Religionssoziologin Grace Davie nannte das die „vicarious religion“ als gesellschaftliche und kulturelle Ressource. Meyer-Blanck sagt: „[… A]lle stattfindenden Liturgien wären ohne die Routine der Hochverbundenen ganz anders, ärmer, weniger lebendig und spirituell.“ Ja, man könnte hinzufügen: Unsere Hochverbundenen halten alte Geheimnisse präsent – sie üben gewissermaßen stellvertretend für uns alle, Sonntag für Sonntag. Damit wir auf etwas zurückgreifen können in der Not – oder etwas umgestalten können, was wenigstens rudimentär noch präsent ist.
Der andere Pol der Diskussion besitzt die Weisheit, dass man nur dort Unterschlupf und Obdach suchen möchte, wo man innerlich auch anschließen kann – wo man sich wirklich zuhause oder wenigstens wirklich willkommen fühlt. Im agendarischen Gottesdienst aber muss man schon sehr viel wissen, um sich nicht fremd zu fühlen: Wann man schlagartig aufstehen muss; welchen genauen Wortlaut die Murmelstücke Vaterunser und Glaubensbekenntnis haben; was die seltsamen Worte eines Wochenpsalms bedeuten sollen; welchen Sinn die vielen biblischen Lesungen haben sollen, deren Zusammenhang sich höchstens Eingeweihten erschließt; warum um Himmels willen man ein Abendmahl feiert, das mit einer Mahlgemeinschaft und dem Sattwerden fast nichts mehr zu tun hat; und man muss Orgelmusik liebhaben, die in vielen Gemeinden musikalisch der Standard ist. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, einzugestehen, dass die Teilnahme an unseren Gottesdiensten nicht voraussetzungslos ist. Implizit erwarten wir dort Anpassung, mindestens aber Respekt. Für nicht gottesdienstlich sozialisierte Menschen ist der agendarische Gottesdienst jedoch vor allem eine Aneinanderreihung von Sprachakten, deren roten Faden sie nicht verstehen können. Er ist eine Zielgruppen-Veranstaltung für hochverbundene, engagierte, ältere Mitglieder.
Meine Position in dem Gottesdienststreit – in dem jeder von uns immer wieder Gefahr läuft, vor allem das Eigene theologisch zu überhöhen –, ist: Ich finde, unsere Gottesdienste sollten möglichst vielen Menschen möglichst viele Reich-Gottes-Erfahrungen ermöglichen. Und wenn es um „möglichst viele“ geht, dann geraten da vor allem andere Gottesdiensttypen in den Blick: Kasualien und Eventgottesdienste. Das jedenfalls beweist nicht zuletzt die Kirchgangsstudie von 2019: Wachsende Gottesdienstformen sind solche mit besonderer Musik, mit Biografiebezug – klar, Kasualien! –, mit Ästhetik und Atmosphäre.
Gottesdienste mit Bezug zum Leben
Die Anlässe dafür sind dann nicht mehr der neunte oder zehnte Sonntag nach Trinitatis, sondern Geburtstagsgottesdienste für Menschen aus dem Stadtteil, Valentinstagsgottesdienste, Pfingsten als Fest der Kommune oder des Stadtteils (Verständigung unter Verschiedenen – was wäre das gerade heute für ein relevantes Thema!); Kindertag, Muttertag, Vatertag, Frauentag … Ich glaube fest an die Kraft einer Kasualisierung des Kirchenjahres.
Das alles braucht Kraft und Herzblut und eine engagierte gemeinsame Vorbereitung. Das wird nur exemplarisch gelingen. Deshalb hat mein Hamburger Kollege Jonas Goebel sein Gottesdienstkonzept auf das Prinzip von Theateraufführungen umgestellt – es gibt in einer Zeitspanne von ungefähr drei Monaten drei bis vier verschiedene Gottesdienstformate (u.a. Wohnzimmerkirche, Lagerfeuer-Gottesdienst, Harry-Potter-Gottesdienst, Gospel-Gottesdienst), die immer wieder identisch laufen (gleiche Predigt, gleiche Lieder, gleicher Ablauf) – dafür aber sehr engagiert vorbereitet sind. Hintergrund seiner Überlegungen ist, dass die meisten Menschen heute anlassbezogen in den Gottesdienst gehen. Das Ergebnis seiner Auswertungen ist: Es kommen mehr Menschen und es kommen andere Menschen. Und es bringen sich mehr Menschen in die Gottesdienstgestaltung ein. Solche Gottesdienste benötigen nicht mehr oder weniger Arbeitszeit, sondern einfach eine andere Arbeitszeit, weil zwar weniger Zeit in die Predigtvorbereitung insgesamt investiert wird, dafür aber mehr Zeit in die Planung der Gottesdienstatmosphäre und auch in die Werbung dafür.
Das ist ein Weg, um mehr Menschen mehr Reich-Gottes-Erfahrungen zu ermöglichen. Ein anderer Weg wäre es, dass an drei Sonntagen im Monat ein kleiner Kreis Ehrenamtlicher die Regelmäßigkeit des Gottesdienstes aufrechterhält, in dem an jedem Sonntag zu einer bestimmten Zeit die Kerzen auf dem Altar angezündet werden, ein Gebet und ein Segen gesprochen und ein einfaches Lied gesungen und vielleicht hinterher noch gemeinsam gegessen wird. Der vierte Sonntag im Monat wird dagegen kooperativ vorbereitet und hat einen biografischen Schwerpunkt – im Sinne einer Kasualisierung des Kirchenjahres.
Um geeignete Formen ringen
Am Ende geht es um das Ziel, nicht um die Form. Justus Geilhufe scheint auch mit regelmäßigen agendarischen Sonntagsgottesdiensten in Sachsen mehr Menschen mehr Reich-Gottes-Erfahrungen zu ermöglichen. Das ist wunderbar – und es liegt neben einem persönlichen Charisma sicher auch an einer anderen Verankerung des Christentums in seinen sächsischen Dörfern. Andere Kolleg*innen brauchen andere Formen, um diesem Ziel näher zu kommen. Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass wir Gott und unser Leben mit und vor ihm regelmäßig feiern, dass wir füreinander und miteinander beten und Worte aus einer anderen Zeit hören, die um dasselbe gerungen hat. Denn das ist würdig und recht – und die Zuflucht, die wir in dieser Welt haben.
Foto von Jason Leung auf Unsplash
AUTORIN · AUTOR

Dr. Emilia Handke leitet das Predigerseminar der Nordkirche. Zuvor hat sie u.a. das Werk „Kirche im Dialog“ in Hamburg aufgebaut.
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!