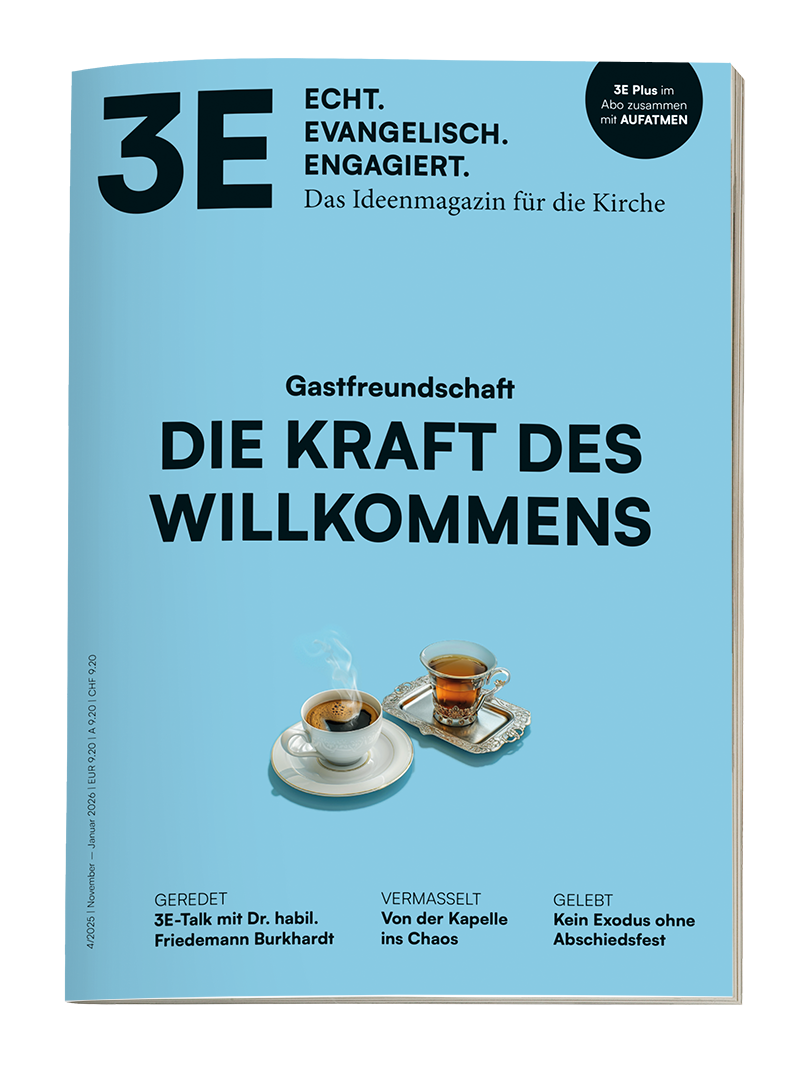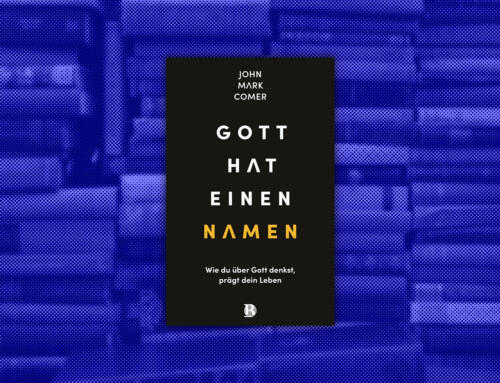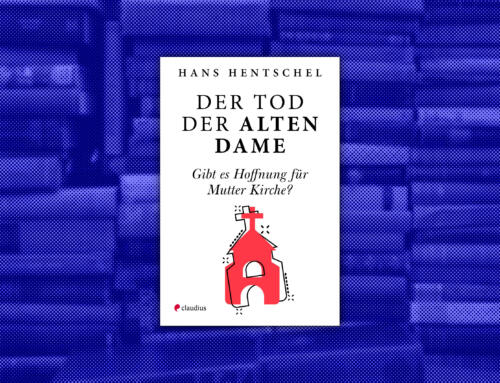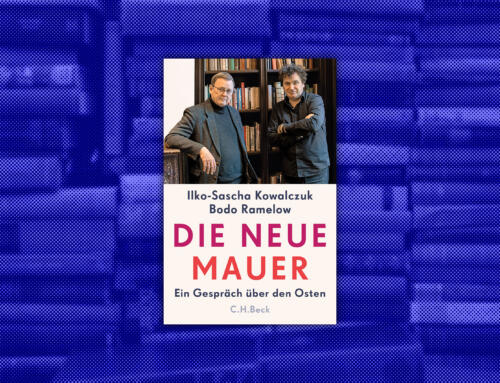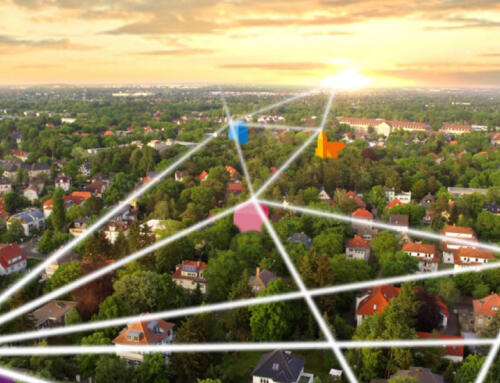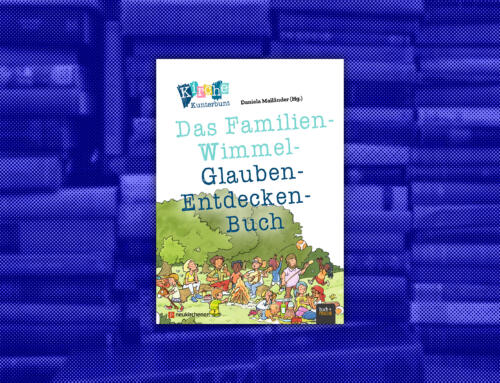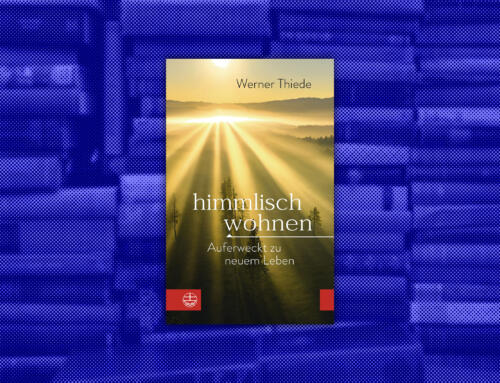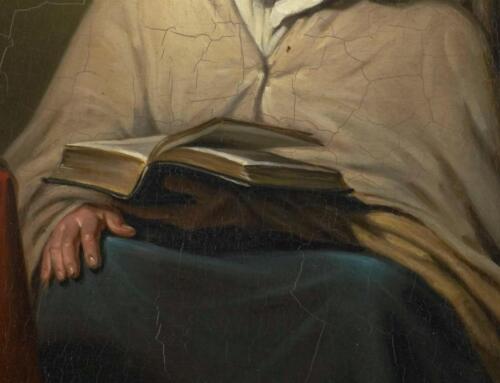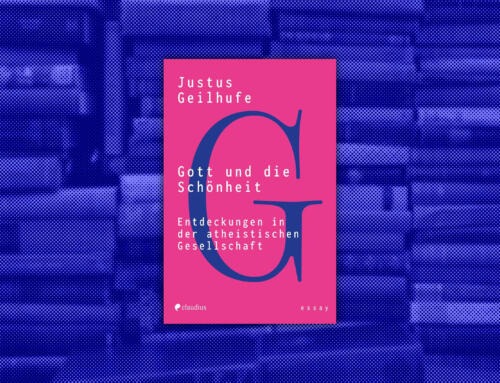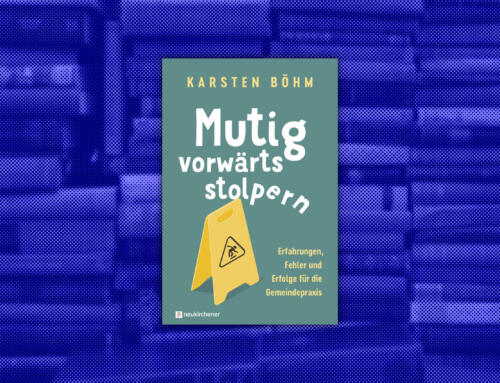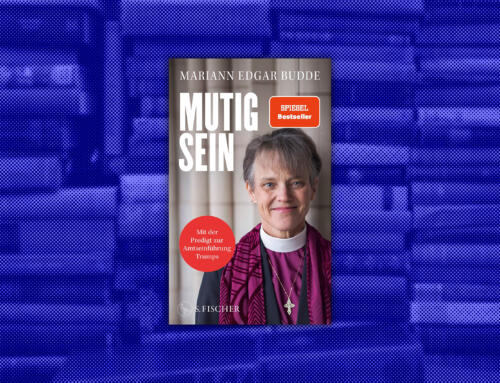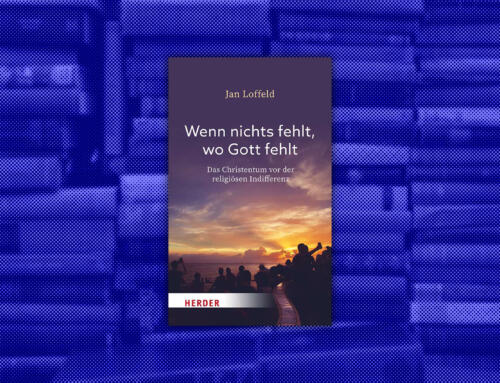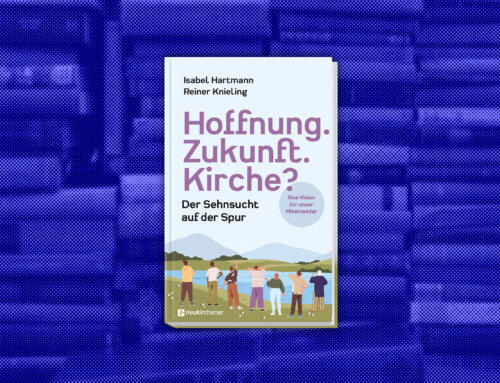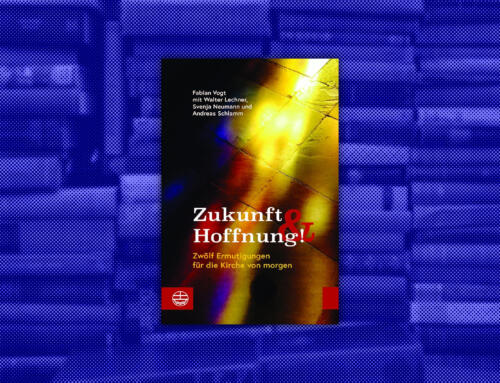Die Kirche ist übern Berg
Die Kirche ist übern Berg
VON Tanja Kasischke
Chemnitz und das Erzgebirge haben als Kulturhauptstadtregion 2025 auch ein christliches Portfolio, seine Marke „Kulturkirche“ wagt sich an Glaubenserlebnisse, ohne den Strukturwandel auszublenden.
Kultur trifft Evangelium, das ist win win. „Kirche kann das“, gibt sich Holger Bartsch kämpferisch und nennt die Kulturhauptstadt 2025 „einen Erprobungsraum, der in Zeiten von Mitgliederrückgang und Marginalisierung der Gemeinden das christliche Selbstwertgefühl neu definieren und stärken kann“. Bartsch ist Theologe und mit einer Sonderpfarrstelle der evangelischen Landeskirche Sachsens für die Kulturhauptstadtkampagne „Kulturkirche“ verantwortlich. Ein Heimspiel, der 55-Jährige stammt aus dem Erzgebirge. Er weiß um den Strukturwandel seiner Kirche – und will die Haltung dazu verändern.
Das Unsichtbare sehen
Mit dem Spruch „C the Unseen“ treten Chemnitz und das Erzgebirge als Kulturhauptstadtregion in Europa an. Chemnitz, die Ungesehene oder, wenn man den Buchstaben C als englisches Verb für sehen (see) liest, das genauso ausgesprochen wird: Seht das Unsichtbare. Der Spruch ist kein Selbstläufer, passt aber zur Persönlichkeit der sächsischen Stadt, einer Mischung aus Zurückhaltung und Selbstbestimmung durch Eigenbrötlerei. Ein Café im Univiertel wirbt wortspielerisch mit den Namen „Karl mags süß“, der Gast stolpert erst, ehe er versteht: Karl Marx war nie hier, ist aber in aller Munde, kommt man denn drauf. Manchmal hilft es, laut zu denken. Understatement kennzeichnet Chemnitz, die Unsichtbare, Dritte der sächsischen Großstädte, die sich hinter dem hippen Leipzig und der aristokratischen Landeshauptstadt Dresden duckt. Und dann plötzlich Kulturhauptstadt geworden ist. Ein Titel, den viele Chemnitzer nicht greifen können.
Für die Kirche ist Unsichtbarkeit nicht neu, aber, da hat Holger Bartsch recht, sie kann das, verkündigt sie doch von dem einen, den noch kein Auge geschaut hat, und was er für seine Gemeinde bereithält. „Die DDR-Geschichte bewirkte, dass die Menschen hier wenig Bezug zur Kirche haben. Kirche hat sich in einer Parallelwelt eingerichtet“, beschreibt Bernard Millard, Vorsitzender von Miteinander für Chemnitz e.V.. Die christliche Initiative ist Teil des ökumenischen Netzwerks der Kulturkirche und hat als erste ein 48-seitiges Jahresprogramm vorgelegt: Motto-Gottesdienste, Gebetstage, Kurse, Feste, Konzerte. „Unser Anspruch war von Anfang an klar, wir wollen dieses Jahr mitprägen und Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringen.“ Deshalb ist die Kulturkirche kein definiertes Gebäude, sondern eine verbindende Marke, die man sich zum Beispiel pilgernd erschließen kann und dabei mal auf historische Kirchenglocken, mal auf Arbeiten regionaler Künstlerinnen und Künstler trifft. Millard, Pastor in Chemnitz‘ Freier evangelischer Gemeinde, kann damit leben, dass auch innovative Formate von Glaube nicht über Vergangenes hinwegkommen. Er setzt deshalb „auf den Mut, die Brüche anzusehen. Unsere Antwort ist Versöhnung. Kirche ist dafür der richtige Ort.“
Wir wollen dieses Jahr Kulturhauptstadt mitprägen und Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringen.
Etliche Veranstaltungen wurden aus eigener Tasche vorfinanziert, „weil bei den Förderern der Kulturhauptstadt unterschwellig Sorge bestand, wir würden zu prägend“, berichtet der Theologe von „teils schwierigen Gesprächen“. Der Eröffnungsgottesdienst zum Kulturhauptstadtjahr in St. Petri, unweit des Chemnitzer Hauptbahnhofs, zu dem 150 Menschen kamen, war eine Randnotiz in der Tageszeitung Freie Presse.
20241130 - Chemnitz: Ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt ins Kulturkirchenjahr 2025 in der St. Petrikirche Chemnitz, "Licht im Advent", Dr. Ulrike Lynn, Pastor Bernard Millard und Pfarrer Holger Bartsch Foto: Sven Gleisberg
Die Parallelwelt verlassen
Dass sich die Abwertung der Institution Kirche so hält, darin sind sich Bernard Millard und Holger Bartsch einig, sei Folge der Parallelwelten. „Da muss Kirche heraustreten. Das heißt, innere Überzeugungsarbeit leisten, auch bei den eigenen Leuten. Im Gebet. Indem man hingeht und sie ermutigt.“ Die über 150 Initiativen und rund 1500 Veranstaltungen der Kulturkirche in Stadt und Region fußen auf einem seit 2021 laufenden Prozess des Zurüstens. Holger Bartsch konnte dabei nicht nur auf die – im Gegensatz zur Stadt Chemnitz – höhere Frömmigkeit der Menschen im Erzgebirge vertrauen, er hatte auch ein Gemeindenetzwerk, das in die Fläche ausstrahlte und lokale Bündnispartner auftat, auf die im Landeskirchenamt niemand gekommen wäre. Die Glaubenserlebnissen aufgeschlossen gegenüberstanden. Die Reihe Bergpredigt ist ein solches, ein Format, das Verkündigung vielgestaltig und ergebnisoffen präsentiert, aber „in Jesu Namen und in Verbundenheit mit ihm“. Statt über die Voraussetzung Glaubensentscheidung funktioniert der Zugang über die Tradition des Bergbaus.
Hinter dem Ausbruch aus der kirchlichen Parallelwelt steckt auch der Anspruch, den Kompass neu auszurichten: Der Strukturwandel im ländlichen Ostsachsen ist ein Bruch, den die Kulturkirche versöhnen will. In vielen Orten fehlen Hauptamtliche, Pfarrstellen bleiben vakant, Gottesdienste fallen weg, es sei denn, engagierte Personen verhelfen kirchlichen Angeboten zum Neuanfang. Holger Bartsch kommt noch einmal auf den Erprobungsraum zu sprechen: „Da gibt es Gemeinden, die sind agil auch ohne Hauptamtliche. Das wird künftig die Regel werden, nicht mehr die Ausnahme. Dazu braucht man halt ein Umdenken.“ Manchmal lohnt es, laut zu denken. Klingt leichter als es ist, schon jetzt erhält Bartsch Anfragen, auf welche Pfarrstelle er wechseln wolle, wenn sein Kulturhauptstadt-Mandat ende. Vom Kurs ab bringt ihn das nicht. Wenn die win win-Bilanz stimme, „trägt dieses Jahr bei, Wege anzulegen mit Potenzial für eine vitale Kirche.“
Anm. d. Red.: Die Veranstalter haben die Zahl der Teilnehmenden beim Eröffnungsgottesdienst nachträglich auf 800 korrigiert.
AUTORIN · AUTOR

Dr. phil. Tanja Kasischke war Redakteurin des Reformationsblogs „Mensch, Martin!“. Seitdem berichtet sie über Themen der missionarischen Gemeindeentwicklung, der Öffentlichen Theologie und wie Kirche den Wechsel von der sprachlosen Parochie zum ansprechenden Netzwerk meistert. Sehr begeistert ist sie von der Wiederentdeckung des prophetischen Amts als Teil der apostolischen Dienstgemeinschaft. Sie lebt in Berlin.
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!