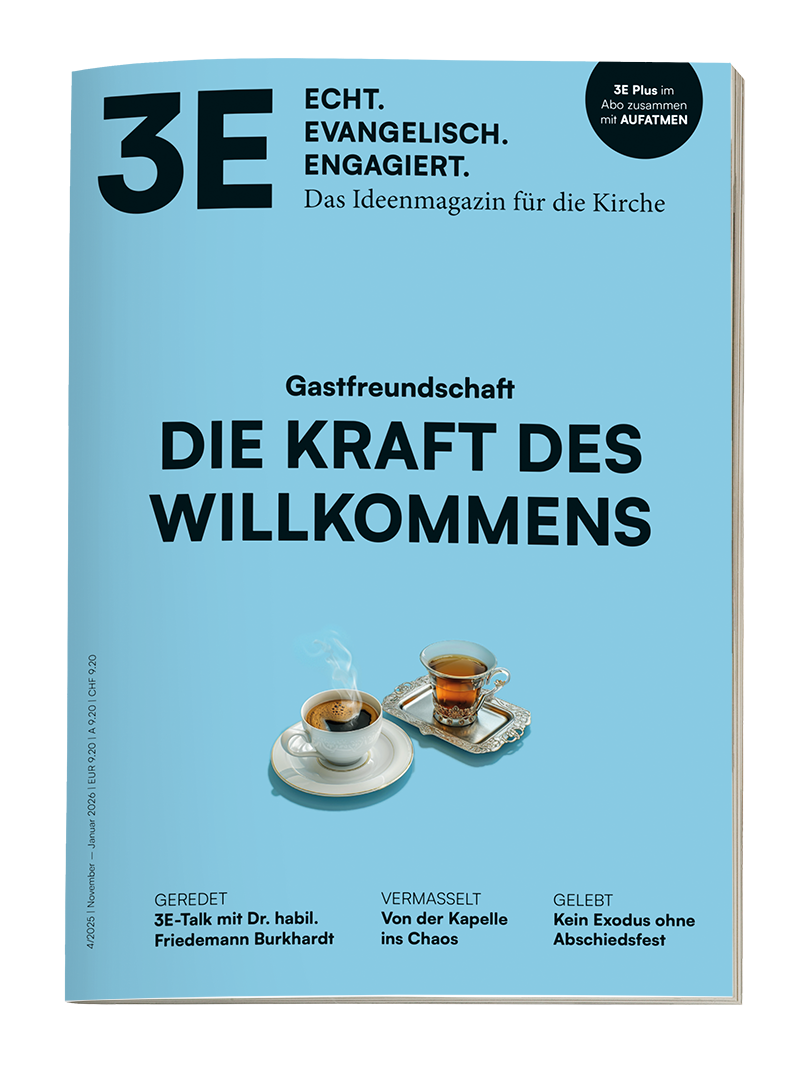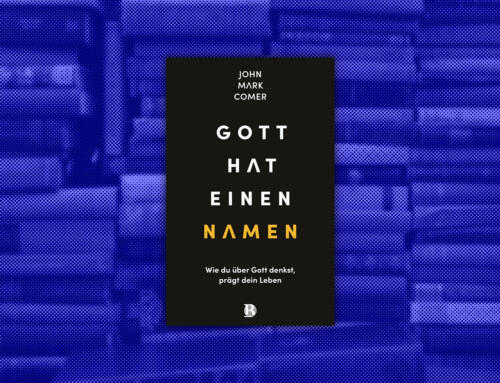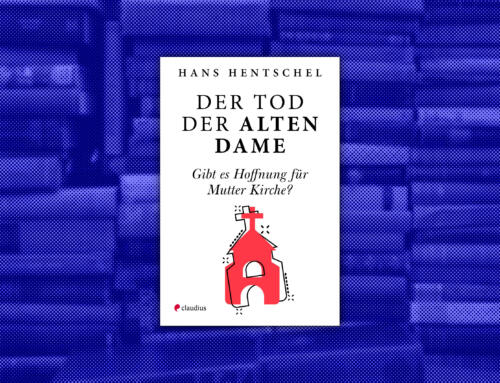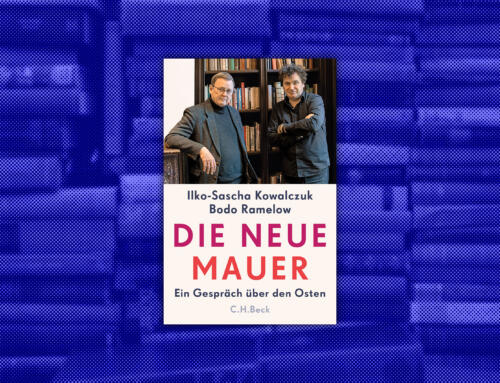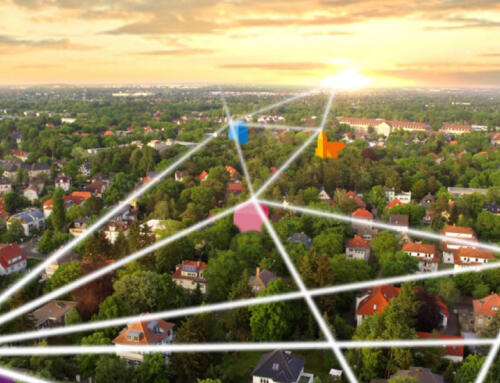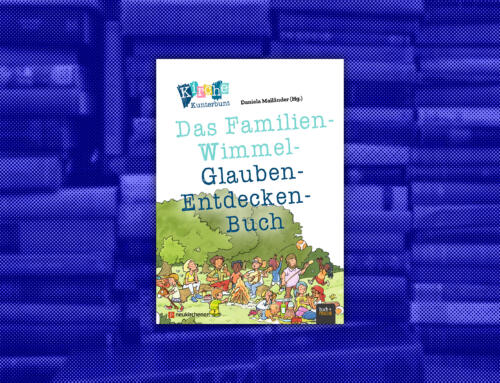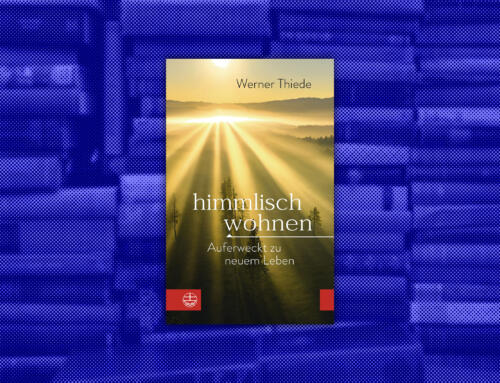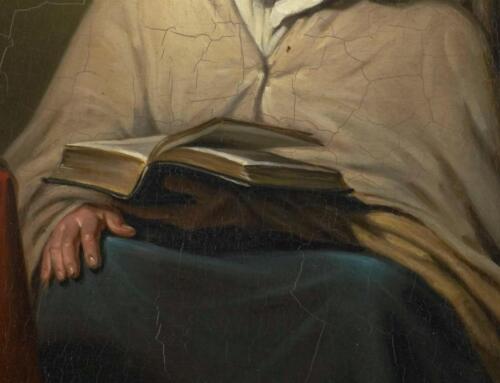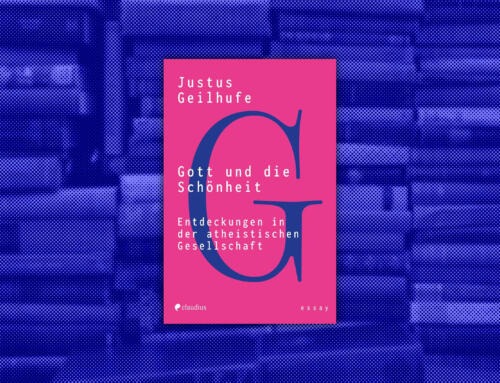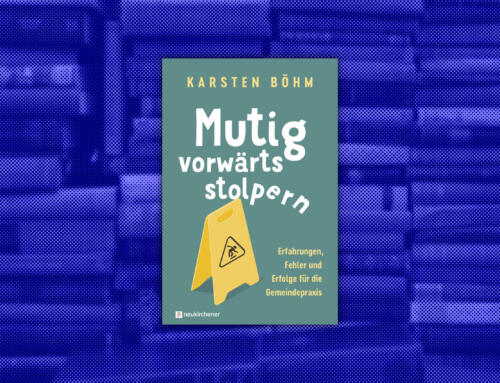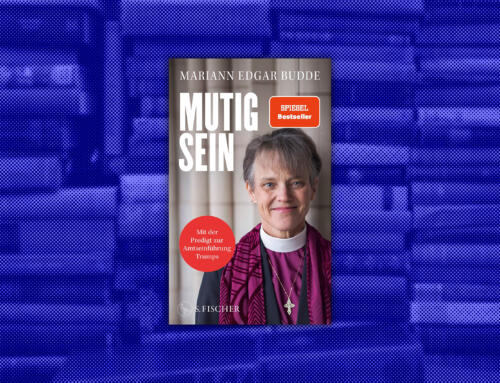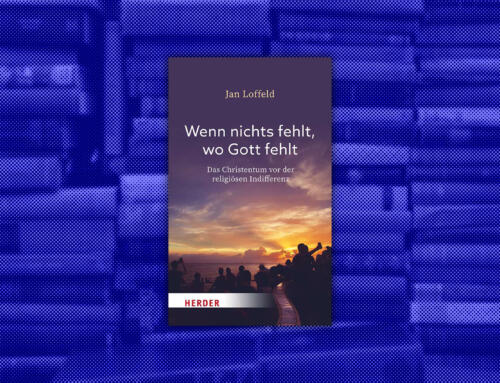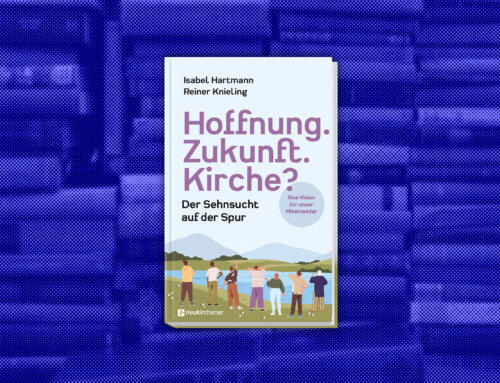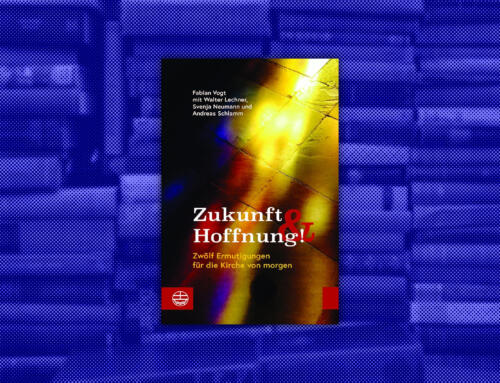Schlachtfest – auch für Veganer!
Schlachtfest – auch für Veganer!
VON Fabian Vogt
Wie wir die „Heiligen Kühe“ in der Kirche loswerden.
Thorsten Latzel, der Präses der Rheinischen Kirche, wird nicht müde zu betonen: „Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Und eine Umfrage des „7. Strategiekongresses“ unter Kirchenleitenden ergab: „61 Prozent der Befragten sind überzeugt: ‚Die jetzige Gestalt von Kirche hat keine Zukunft.‘“ 61 Prozent! Der Kirchenleitenden! Hallo!
Mit anderen Worten: Wir wissen, dass wir was tun müssen … und wir wissen auch, was zu tun ist. Wir machen es nur nicht. Oder zumindest noch viel zu ängstlich. Warum? Die Antwort ist ganz einfach: Wegen der „Heiligen Kühe“! Wegen einer ganzen Herde sakral-viraler Viecher, die penetrant in unseren Köpfen grasen und uns weismachen, sie wären für die Kirche unabdinglich. Das bedeutet: Ganz gleich, was an neuen Ideen entsteht: Es stößt ständig auf diese Herde „Heiliger Kühe“ … und zieht dabei allzu oft den Kürzeren. Muh!
Die Grunderkenntnis bei allen ‚Heiligen Kühen‘ lautet: Wenig an ihnen ist im Kern biblisch.
Eine „Heilige Kuh“ ist qua Definition – angelehnt an die als heilig geltenden Kühe im Hinduismus – ein Tabu, also etwas, an dem nicht gerüttelt werden darf. Und klar ist: Solange wir im Großhirn solche Tabus haben, wird es in der Kirche keine Innovationen geben. So lange wirken die „Heiligen Kühe“ wie Ketten, wie Bremsklötze, wie Dementoren, die uns die Energie aussaugen und alles blockieren. Dieser Artikel ist deshalb die Einladung zu einem Schlachtfest – auch für Veganer. Lasst uns die „Heiligen Kühe“ schlachten, ein rituelles Barbecue machen und danach befreit anfangen, die notwendigen Veränderungen anzugehen.
Von Rindviechern und anderen KUHriositäten
Die Grunderkenntnis bei allen „Heiligen Kühen“ lautet: Wenig an ihnen ist im Kern biblisch. Wir reden fast immer über Traditionen, die sich im Lauf der Jahrhunderte entwickelt haben. Deswegen können sie trotzdem kostbar sein – aber sie verlieren ihre Daseinsberechtigung, wenn sie notwendige Transformationsprozesse verhindern. Oder um es noch deutlicher zu sagen: Wenn sie dem Evangelium im Weg stehen.
Ist am kommenden Sonntag RICHTIGER Gottesdienst – oder wieder so ein moderner Kram?
Apropos „Stehen“: Bis ins Mittelalter haben Menschen im Gottesdienst gestanden, danach wurden Kirchenbänke eingebaut. Das war damals eine Erleichterung. Allerdings: Nach heutigem Verständnis von Sitzkomfort gleichen manche dieser inzwischen antiken Möbelstücke eher Folterinstrumenten, die nach den Genfer Konventionen verboten werden müssten. So sehr, dass selbst bräunliche Sitzkissen nicht helfen; abgesehen davon, dass man eine Kirche mit Stühlen wesentlich vielfältiger und attraktiver nutzen kann. Wenn dann Nostalgiker sagen: „Egal, ob sich da jemand freiwillig draufsetzt oder nicht – aus Denkmalschutzgründen müssen die Dinger bleiben“ – dann haben wir sie: eine „Heilige Kuh“; einen wesensfremden, kulturell tradierten Bremsklotz für Erneuerung.
Viel mächtiger und gewaltiger als so ein Einrichtungsgegenstand, dem fälschlicherweise Macht über geistliche Prozesse verliehen wird, sind aber – wie gesagt – die „Heiligen Kühe, die sich in unserem Kopf eingerichtet haben. Ich nenne mal ein paar stellvertretend:
- Selbstgenügsamkeit. Ich bin vor kurzem umgezogen und suche gerade eine neue Gemeinde. Das heißt: Ich gehe fast jeden Sonntag in einen anderen Gottesdienst. Und viele davon strahlen vor allem eine Botschaft aus: „Wir sind uns selbst genug.“ Auch wenn kaum jemand da ist. Das heißt nicht, dass ich nicht von netten Menschen angesprochen würde, aber um den Gottesdienst zu verstehen, müsste ich meist ein Studium der Kryptologie absolvieren. Ich kenne viele der Wechselgesänge nicht (oder zumindest nicht so), die Leute stehen unerwartet auf, die im Gesangbuch eingeklebte Liturgie stimmt nicht (zudem ist sie meist ohne Noten und ich finde sie auch nur durch Zufall) – und bis heute weiß ich nicht, ob „Die Kirchis“, zu denen ich eingeladen wurde, ein Jugendtreff, ein Seniorenkreis oder die Mitglieder des Bauausschusses sind. Ich bin (und bleibe) Fremdling in einem rituellen Geschehen, dass ich mir zwar als Theologe erklären kann, das aber nichts mit mir zu tun hat. Eine derartige Innenorientierung („Hauptsache, ich versteh‘s!“) ist eine „Heilige Kuh“.
- Fokussierung auf das Amt. Wir können noch so viel von der Bedeutung der Ehrenamtlichen in den Gemeinden schwärmen: In den meisten Köpfen herrscht eine unausgesprochene Hierarchie. Das bedeutet etwa: Der Geburtstagsbesuch zählt bei den Menschen nur dann als vollwertig, wenn ihn eine Pfarrperson macht, laut einer aktuellen Studie gehen 12 Prozent aller Gottesdienstbesuchenden nicht zum Abendmahl, wenn es von Prädikanten ausgeteilt wird, in den meisten Landeskirchen dürfen Laien keinen Talar tragen – und natürlich dürfen sie auch nicht verantwortlich Abendmahl feiern. Solange es vielerorts ein solches Zwei-Klassen-Christentum gibt, müssen wir uns nicht wundern, dass es schwerfällt, Gemeinden als Ganzes zu motivieren: Anstatt Zuständigkeiten zu delegieren, Begabungen zu nutzen, Freiräume zu schaffen und als „Gemeinschaft der Heiligen“ gemeinsam Verantwortung für das Miteinander der Glaubenden zu übernehmen, bleibt die geistliche Zuständigkeit bei den Pfarrerinnen und Pfarrern. Diese Konzentration auf die Ordination ist eine „Heilige Kuh“.
- Gebäude-Zentralismus. Wir machen uns das oft nicht bewusst, aber unsere Gebäude haben massiven Einfluss auf die Gemeindearbeit. Bis dahin, dass vielen immer noch alles verdächtig erscheint, was nicht in der Kirche stattfindet: „Hauskreise – das ist doch garantiert evangelikal.“ – „Yoga im Gemeindehaus – alles heidnischer Kram.“ „Trauung am Baggersee – muss ja nun wirklich nicht sein.“ Und ich warte gespannt auf den Tag, an dem eine Gemeinde sagt: „Wir müssen sparen und ein Gebäude abstoßen. Wisst ihr was: Wir behalten das viel praktischere Gemeindehaus und verzichten auf die Kirche.“ Das führt auch dazu, dass der wesentliche Maßstab aller Erneuerungen weiterhin lautet: „O.k. – ihr macht da irgendein innovatives Projekt. Alles schön und gut, aber: Hat sich dadurch die Kirche gefüllt?“ Kirche hängt in vielen Köpfen massiv am Kirchengebäude. Darum fällt es uns so unfassbar schwer, Gemeinde in neuen Formen zu denken, im Stadtteil, im Kino, in der Kneipe, auf dem Markt. Das Klammern an architektonische Gegebenheiten ist eine „Heilige Kuh“.
- Liturgie-Hörigkeit. Ein Freund von mir macht seit 25 Jahren alternative Gottesdienste. Mit großem Erfolg. Dabei erreicht er in der Regel etwa fünfmal so viele Menschen wie in einem Gottesdienst mit klassischer Liturgie. Trotzdem fragen ihn viele Gemeindeglieder regelmäßig: „Ist am kommenden Sonntag RICHTIGER Gottesdienst – oder wieder so ein moderner Kram?“ Verrückt, oder? Die Agende gilt weiterhin als normativer Standard, an dem sich alles messen muss. Warum eigentlich? Vor allem aber: Es gibt doch ohnehin nicht DIE richtige Kirche. Zumindest nicht, was die Form angeht. Kirche war schon immer vielfältig und darf wieder vielfältiger werden. Und das gilt nicht nur für die Liturgie, sondern auch für die Musik, den Ort, die Gottesdienstelemente und -zeiten, die Kleidung, den Stil, die Sprache und vieles mehr. So eine massive Kulturverengung ist eine „Heilige Kuh“!
Auf zum großen Schlachten!
Wie gesagt: Da müssen wir ran. Endlich. Und das Standardargument vieler treuer „Kuh-Hirten“ – „Wenn wir was ändern, verlieren wir auch noch die letzten Standhaften“ – ist, mit Verlaub, Unsinn. Frag doch mal die Alten, ob sie zufrieden damit sind, immer nur mit 15 weiteren Alten dazuhocken. Ich zumindest erlebe da viel Offenheit für Veränderung. Also: Wie schlachtet man „Heilige Kühe“? Hier drei erste Anregungen für ein fröhliches „Schlachtfest“.
1. Lasst uns ganz neue Kirchenbilder träumen
Wenn wir die ersten Christinnen und Christen wären und nichts von den heutigen Strukturen hätten – keine Kirchen, keine Pfarrerinnen und Pfarrer, keine Liturgie – nur den Wunsch, unseren christlichen Glauben zu feiern und ihn mit anderen zu teilen: Wie sähe dann unsere ganz persönliche „Kirche“ aus? Was gehört für uns unabdingbar dazu? Und was bräuchten wir überhaupt nicht? Ich verspreche: Das wird ein äußerst anregendes Gespräch.
2. Lasst uns ein Klima der Veränderung schaffen
Wenn alles auf dem Prüfstand steht, dürfen wir auch Neues wagen. Vielleicht erst mal nur für drei Monate. Mit Ankündigung im Gemeindebrief und in der Zeitung. Anschließend gibt es eine Gemeindeversammlung und alle diskutieren: War die Alternative gut oder nicht? So entsteht eine positive Atmosphäre der Erneuerung, es dürfen auch Fehler gemacht werden, und Menschen bekommen Mut, einfach mal was auszuprobieren. Lohnt sich!
3. Lasst uns leidenschaftlich anfangen
Der schlimmste Satz, den ich je von einem Kollegen gehört habe, lautet: „In meinen Gottesdienst würde ich auch nicht gehen.“ Ahhh! Darum: Wir sollten – bei aller Offenheit für Außenstehende – bewusst Dinge machen, die wir selbst lieben. Weil nur begeisterte Menschen andere begeistern. Und die Frage: Wie kann ich die Leidenschaft in mir neu entfachen ist nicht nur zutiefst geistlich, sondern der Anfang aller Veränderung.
Letztlich geht es bei diesem „Schlachtfest“ um ein Reframen unserer Wahrnehmung: Weg von klerikalen Mustern, die Transformation verhindern, hin zu einem befreiten Glauben, der sich von „Heiligen Kühen“ nicht aufhalten lässt. Muh!
AUTORIN · AUTOR

Dr. Fabian Vogt ist Theologe und Schriftsteller. Er arbeitet mit einer halben Stelle als Referent für Evangelisation bei midi, der Zukunftswerkstatt für Kirche und Diakonie in Berlin.
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!