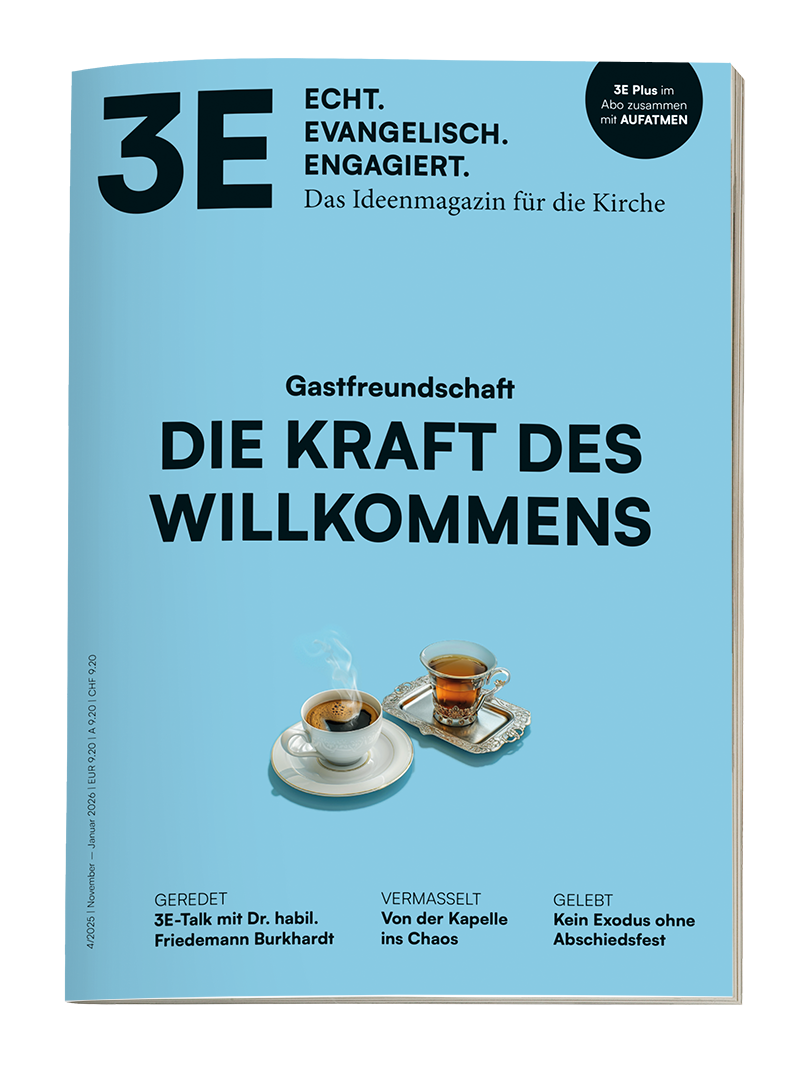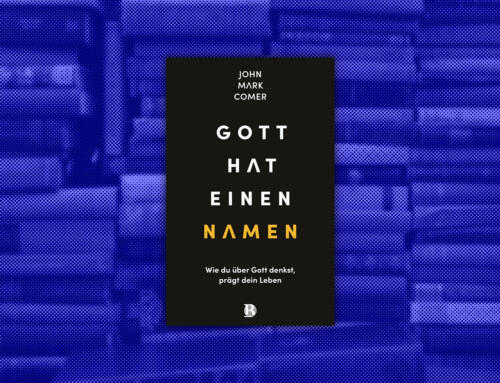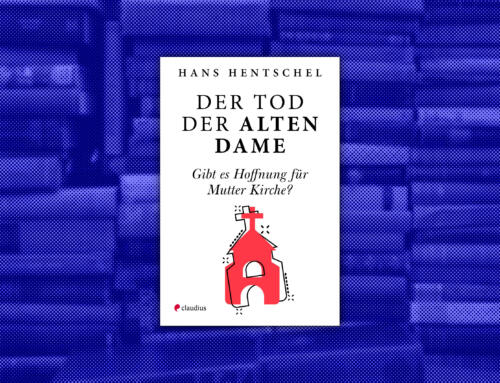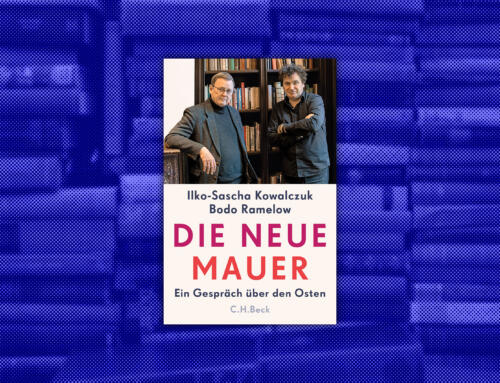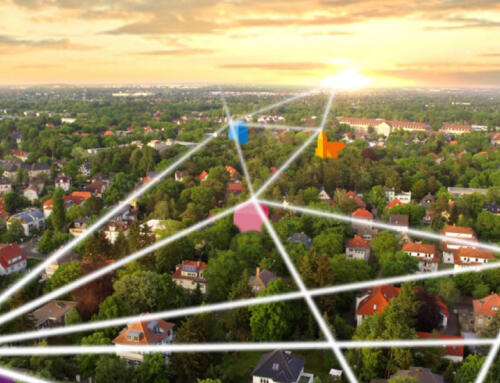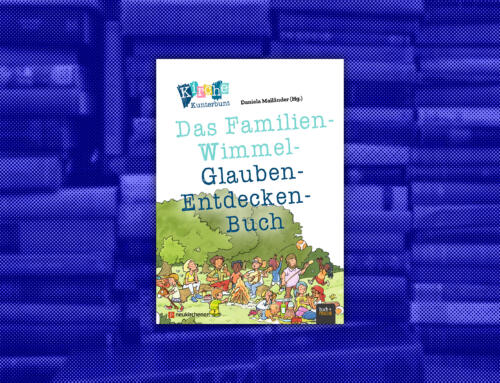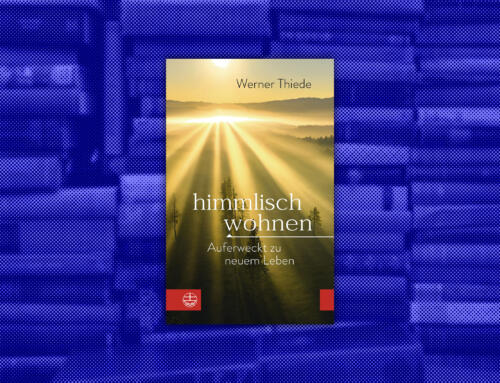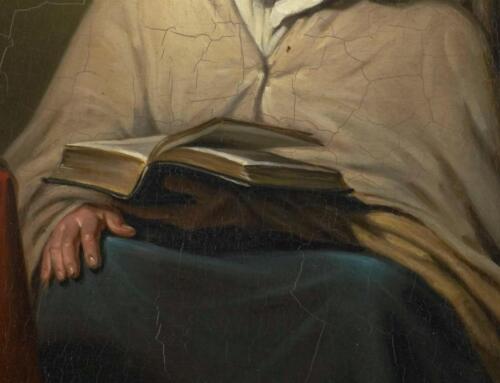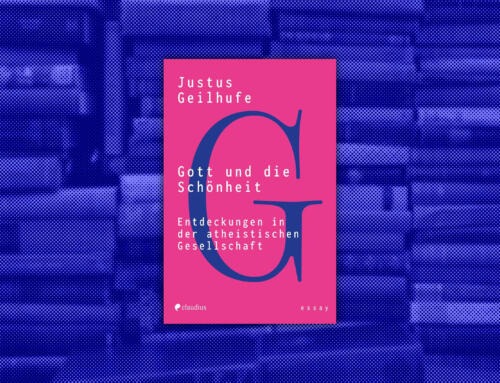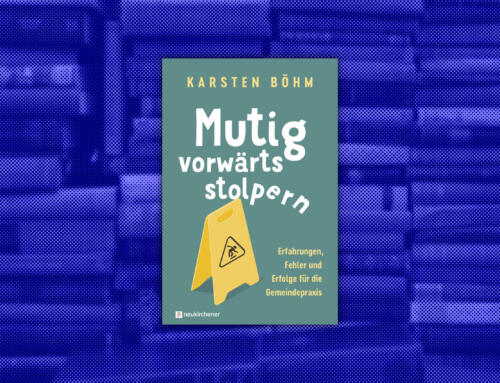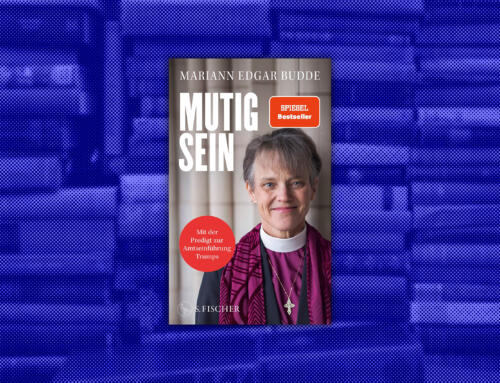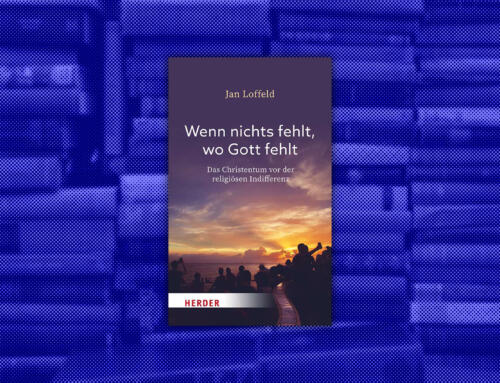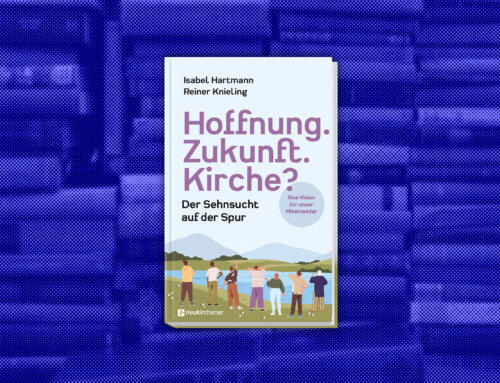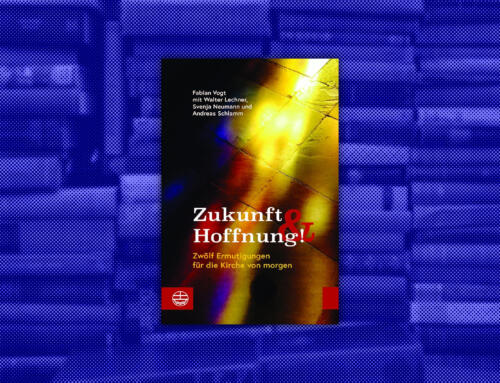Gott fängt nochmal neu an! – Wie Kirche Zukunft gewinnt
Gott fängt nochmal neu an! – Wie Kirche Zukunft gewinnt
VON Andreas Schmierer
Was, wenn Gott noch einmal mit seiner Kirche in Europa völlig neu anfängt? Man kann es drehen und wenden, wie man will: Gott scheint ein Faible für Monopoly zu haben und etwa alle 500 Jahre „Gehe zurück auf Los und lass deine vermeintlichen Sicherheiten hinter dir!“ zu rufen: die Hinwendung zur klösterlichen Spiritualität nach dem Untergang des römischen Reiches (Ende 5. Jh.), die große Kirchenspaltung 1054 mit der Trennung in West- und Ostkirche sowie 1517 die Reformation. Der frühere Bischof der Episcopal Church of Bethlehem, Mark Dyer, hat diese These aufgestellt. Unabhängig, ob es alle 500 Jahre passiert: Als Christen glauben wir an einen Gott, der immer wieder Neues schafft. Etwa im israelischen Exil in Babylon in völliger Niedergeschlagenheit: „Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Jes 43,18) Oder indem Jesus am Kreuz für unsere Schuld sühnt – und einen Neuanfang mit Gott ermöglicht.
Jammern verboten!
Ein Dienstagabend im Winter. 20 Uhr. Fünfzehn Menschen sitzen neugierig auf ihren Stühlen im Seminarraum im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Knapp zwanzig sind digital zugeschaltet. An zehn Abenden wollen Gemeindeglieder, Kirchengemeinderäte, Pfarrerinnen und Studierende in einer Denkwerkstatt überlegen, wie Gemeinde in Zukunft mutig und vertrauensvoll gestaltet werden kann. Eine muntere Truppe. Diskussionsfreudig, engagiert, kritisch. Für die Abende gab es eine Regel: Kein Jammern über die gegenwärtige Situation und kein Schimpfen oder Schuldzuweisungen an die Kirchenleitung, sonst hätte ich Schmerzensgeld für das Seminar verlangt. Konstruktive Kritik, Träumen und Ideen kreieren dagegen – sehr erwünscht. Wir haben nicht die Masterformel für die Rettung der Kirche gefunden. Aber das war auch nicht das Ziel. Es waren kleine Tools und Impulse, die wir vermittelt und direkt ausprobiert haben – wie die Sozialraumanalyse oder Fragen der regiolokalen Zusammenarbeit. Die Reaktionen waren stark: Kirchengemeinderäte, die fröhlich Ideen für einen Glaubenskurs im Industriegebiet spinnen; Ehrenamtliche, die neu erkennen: Wir haben eine Verantwortung für den Sozialraum und die Menschen an unserem Ort.
Die Krise der Kirche ist eine geistliche Krise
In der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD (KMU VI) weht uns ein anderer Wind entgegen. Nur 29 % der evangelischen Mitglieder glauben, „dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat.“ Das tut weh. Im Fußball heißt es oft, wenn ein Trainer nach drei sieglosen Spielen in Serie entlassen wird: „Er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht.“ Als Kirche müssen wir uns Ähnliches eingestehen: Wir verlieren gerade Mitglieder, die wir als Kirche nie in einem tieferen geistlichen Sinn erreicht haben, denen wir unsere Freude am Evangelium von Jesus Christus nicht nahebringen konnten und die keine lebendigen Jünger Jesu geworden sind. Dieser rapide Mitgliederrückgang hat Konsequenzen. Prof. Michael Herbst hat es kürzlich auf die Punkt gebracht: „[Wir] verlieren in immer größeren Gebilden den Kontakt zu den Nahbereichen menschlichen Lebens und treffen auf Gemeinden, die nicht geübt sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.“ Autsch!
Ängstlich klammern wir uns lieber an überkommene Strukturen wie ein Vollversorgungsprogramm an jedem Ort als an Jesus Christus und seine Zusage, dass seine Kirche in Ewigkeit Bestand haben wird. Der Soundtrack, den ich in Landeskirchen wahrnehme, ist eher Titanic-Untergangsstimmung à la „Time to say Goodbye“ als „In Christus ist mein ganzer Halt“. Ohne Zweifel: Der gegenwärtige Rückgang kirchlicher Mitgliedschaft und des Gottesdienstbesuchs ist an vielen Orten massiv. Gebäude werden verkauft, der Kirchenchor hört auf. Das sind schmerzliche Erfahrungen und sie sollten angemessen betrauert werden. Es gab Zeiten, da war es „in“ und selbstverständlich sich der Kirche zugehörig zu zeigen. Es brachte Vorteile oder gesellschaftliche Anerkennung. Doch Tradition allein begründet keinen (gesunden) Glauben. Heute ist Glaube eine Option unter vielen. Wer jetzt in der Gemeinde auftaucht, kommt aus Überzeugung oder mindestens aus Interesse. Das ist vielleicht ernüchternd, aber gewiss ehrlicher.
Häuser und Herzen öffnen
Wie kommen wir in geistliche Nahbereiche und wie lernen Gemeinden ihr Leben in die Hand zu nehmen? Aus der Konversionsforschung wissen wir: Die Mehrheit derer, die zum Glauben kommen, hatten zuvor persönliche Beziehungen zu Christen. Warum nicht Gastfreundschaft und Beziehungspflege priorisieren? Und dabei keinesfalls Menschen als Missionsobjekte degradieren, sondern echtes Interesse an deren Lebenswelt und Einstellungen zeigen und authentisch von dem erzählen, was uns trägt. Und wie geht das? Keineswegs triumphierend, überheblich und schon gar nicht mit Druck – vielmehr bittend, bezeugend, begeisternd. Es wird weiterhin hier und da größere Evangelisationen geben, aber der Großteil wird an den Küchentischen und auf dem Sofa geschehen. „The Gospel comes with a housekey“, lautet der Titel eines Buches von Rosaria Butterfield. Für die frühere Atheistin waren ein offenes Haus, ein gedeckter Tisch und hörende Ohren der Weg zum Glauben. Weil Menschen ihr Leben für Rosaria geöffnet haben, konnte sie ihr Herz öffnen.
Ängstlich klammern wir uns lieber an überkommene Strukturen.
Alan Noble hat herausgefunden, dass postmoderne Menschen eine gewisse Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben zeigen, wenn sie bemerken, dass säkulare Deutungen unserer Wirklichkeit an Grenzen kommen, keine Antwort bereithalten oder gar zerbrechen: in existentiellen Situationen von Leid, Schmerz und Tod.
Kurswechsel dringend erforderlich!
Kürzlich war ich zu einem alternativen Abendgottesdienst in eine Gemeinde eingeladen. In der kühlen Kirche saßen am Sonntagabend über 200 Leute – quer durch alle Altersgruppen. Ein Vielfaches des Zehn-Uhr-Gottesdienstes. „Das liegt an Ihrem Thema!“, sagte mir die Organisatorin. „Von Gott enttäuscht“ war mein Predigttitel. Tim Keller war davon überzeugt, dass genau für diesen Kairos Christen bereit sein müssen, um Antwort zu geben „über die Hoffnung, die in euch ist“ (1Petr 3,15). Dafür braucht es Sprachfähigkeit, Hauptamtliche, die Schulungen anbieten sowie Glaubens- und Nachfolgekurse.
Wir können nicht im Zeitalter „nach der Volkskirche“ auf Strategien setzen, die wir in einer volkskirchlichen vergangenen Ära eingeübt haben. Das muss scheitern – früher oder später. Das bestätigt auch Prof. Sabrina Müller: „Wenn wir so weitermachen, implodiert das ganze System.“ Bezeichnend ist die überkommene Institutionslogik mit der Kirche agiert. In Württemberg werden die Strukturanpassungsmaßnahmen als Pfarrplan bezeichnet und somit weiterhin Pfarrerinnen und Pfarrern als entscheidende Größe betrachtet. Weshalb gibt es keinen Gemeindeplan? Bezeichnend ist die große Sorge über fehlenden Pfarrer-Nachwuchs und zugleich eine Sorglosigkeit angesichts des geistlichen Grundwasserspiegels ihrer Mitglieder.
Jesus Christus ist immer noch Herr seiner Kirche.
Wir brauchen eine Breite an Angeboten, Veranstaltungen und Gemeindeformen. „One fits all“-Lösungen sind überholt: niederschwellige Pop-Up-Churches, Segenstankstellen genauso wie Alphakurse, Kleingruppen mit Bibelgespräch und offene Kirchen mit Gebets- und Gesprächsmöglichkeit. Es ist wunderbar, welche kreativen Ideen hier entstehen. Zugleich müssen wir kritisch evaluieren: Welchen Beitrag leistet eine Aktion auf dem Weg zu einem lebendigen und mündigen Christsein? Wie geht es nach dem Event weiter?
Exklusiv und inklusiv zugleich
Für Furore sorgte das frühe Christentum, weil ihm beides gelang: Mitten in der antiken, nicht-christlichen Welt zu leben und zugleich nicht von dieser Welt bestimmt und wahrnehmbar anders zu sein. Ein im besten Sinne exklusiver Inhalt (die Person Jesus Christus und seine befreiende, lebensverändernde Botschaft), der zugleich inklusiv verstanden breit zugänglich gemacht wird. Nein, wir wollen kein romantisch verklärtes Urgemeinden-Christentum – und dennoch: Es sind sehr ähnliche Themenbereiche, bei denen Religion heute laut KMU VI für Kirchenmitglieder keinerlei Bedeutung hat, die in der Urgemeinde jedoch den Unterschied machten (Sexualität, Arbeit, politische Einstellungen, Kinder) Wer sich fragt, weshalb das Christentum einen derartigen Erfolg hatte, wird auf folgende Aspekte stoßen: Multikulturalität, Fürsorge für Kranke und Außenseiter, Vergebung statt Vergeltung, Einsatz für den Schutz des (ungeborenen) Lebens und gegen Kinderopfer und eine revolutionäre Sexualethik, die für Frauen ungemein attraktiv war. Ist gerade jetzt vielleicht die Zeit für ein Comeback dieser Werte?
Wir haben eine Verantwortung für den Sozialraum und die Menschen an unserem Ort.
Und jetzt? Jesus Christus ist immer noch Herr seiner Kirche. Unser Auftrag (Mt 28,18-20) gilt weiterhin und es bleibt die „beste Entscheidung für jeden Menschen“ (Justin Welby) ein Nachfolger Jesu zu werden. Könnte es sein, dass Gott unser Bewusstsein schärfen und uns neu von ihm abhängig machen will? Könnte es sein, dass Gott mit einer ärmeren, kleineren, schwächeren, weniger pfarrerzentrierten Kirche nochmals neu anfängt und andere Wege gehen will? – Ich glaub’s!
AUTORIN · AUTOR

Andreas Schmierer ist Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und Studienassistent für Praktische Theologie im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Ehrenamtlich engagiert er sich im 3E-Redaktionsteam.
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!