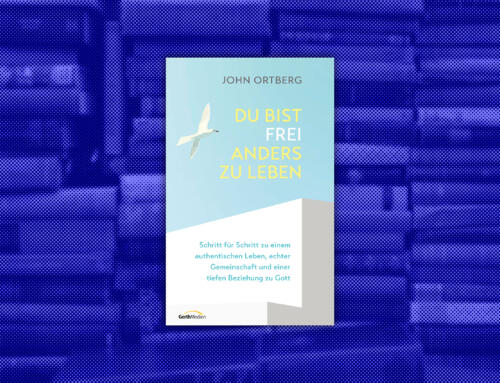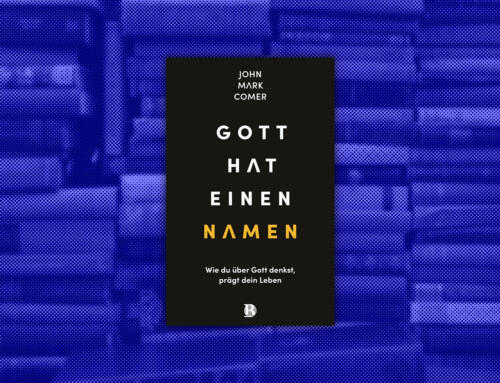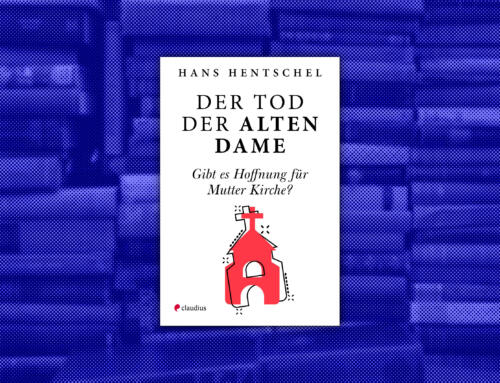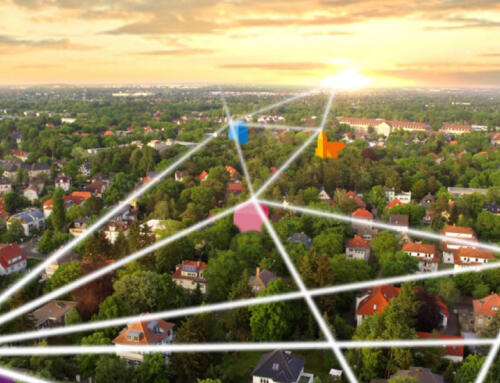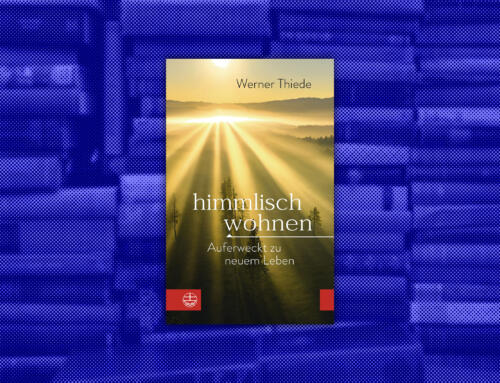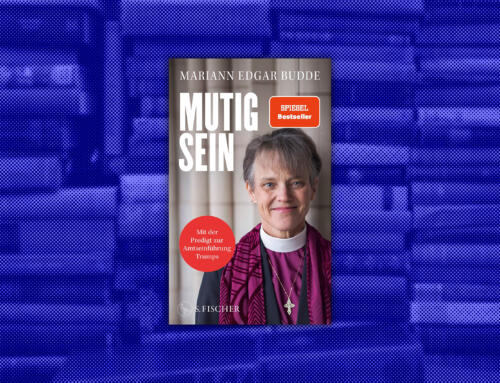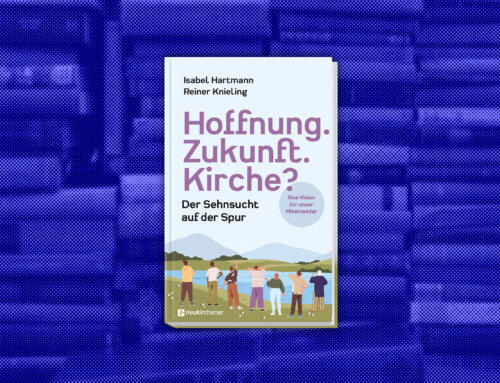Die heruntergekommene Kirche
Die heruntergekommene Kirche
VON Rüdiger Jope
Als eine fundamentale „Transformation“ bezeichnet der Priester und Prof. Jan Loffeld das, was er in unserer Gesellschaft beobachtet. Während früher Gott meistens zumindest mitgedacht worden ist – entweder positiv oder negativ bewertet -, kommt er im Denken der jüngeren Generation gar nicht mehr vor. Ein Gespräch über religiöse Indifferenz, Reformation und ein Schwinden der Kirche
Apa-Theismus ist einer Ihrer Schlüsselbegriffe, wenn Sie über die säkulare Gesellschaft sprechen. Was meinen Sie damit?
 Apatheisten sind Menschen, die gar keine Fragen mehr an Religion haben. Die also nicht nur die Kirche als Organisation nicht mehr als relevant empfinden, sondern sich auch den Botschaften, den Inhalten keine Bedeutung zumessen. Auch das Thema „Sünde“ spielt für sie überhaupt keine Rolle mehr. Der Begriff „Apatheismus“ kommt übrigens aus dem Angelsäschischen und wird auch vom tschechischen Theologen Tomas Halik verwendet. Halik allerdings hat dies nicht weiter verfolgt, sondern sich dann eher den „Seekers“, den Suchenden zugewandt.
Apatheisten sind Menschen, die gar keine Fragen mehr an Religion haben. Die also nicht nur die Kirche als Organisation nicht mehr als relevant empfinden, sondern sich auch den Botschaften, den Inhalten keine Bedeutung zumessen. Auch das Thema „Sünde“ spielt für sie überhaupt keine Rolle mehr. Der Begriff „Apatheismus“ kommt übrigens aus dem Angelsäschischen und wird auch vom tschechischen Theologen Tomas Halik verwendet. Halik allerdings hat dies nicht weiter verfolgt, sondern sich dann eher den „Seekers“, den Suchenden zugewandt.
Das heißt in der Konsequenz: Wo kein Schuldbewusstsein mehr vorhanden ist, gibt es auch kein Erlösungsbedürfnis mehr?
Luther fragte im 16. Jahrhundert nach dem gnädigen Gott, das zwanzigste Jahrhundert ist geprägt von der Frage nach der gnädigen Kirche. Und heute fragen die Menschen nach einem gnädigen Zugang zu sich selber, zur eigenen Biographie, zum eigenen Körper oder zur Umwelt. Es geht nicht mehr um die vertikale Orientierung zwischen Mensch und Gott, sondern horizontal: der Mensch versöhnt sich mit sich selbst, und so weiter. Da ist vieles gut und richtig, aber es hat eben nichts mit Religion oder Gottvertrauen zu tun.
Wir arbeiten immer noch als Optimierer an der Kirche, statt die Gottesfrage in den Mittelpunkt zu stellen.
Wir sind so groß geworden, dass jedem Menschen die Sehnsucht nach Gott irgendwo innewohnt und dass wir diesen Punkt nur finden und berühren und entzünden müssen.
Da gibt es ja lange theologische Traditionen, Schleiermacher und Rahner nenne ich hier mal stellvertretend. Und nein, wir können den Menschen nichts andrehen oder unterschieben, was nicht mehr da ist. Die Reaktionen auf mein Buch „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt“ zeigen mir, dass viele das genauso erleben, wie ich es beschrieben habe. Das Buch ist ja nicht für den theologischen Universitätsdiskurs geschrieben, sondern für ganz normale Menschen, die in der Seelsorge tätig sind.
Wie reagieren die denn?
Sie bestätigen, dass sie diese Gottesvergessenheit in ihren Gesprächen so erleben. Übrigens in einem noch größeren Ausmaß als ich es erwartet habe. Sie haben aber Recht, wir sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch mit einem ganz anderen Paradigma groß geworden.
Noch ein paar Jahrhunderte weiter zurück. Augustinus sagte: „Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir.“ Das war einmal?
Zumindest stimmt es für viele Leute nicht mehr. Dass sie nicht mehr schlafen können, weil sie sich sündig fühlen oder von ihrer Schuld verfolgt werden. Ich würde es so sagen: Jeder Mensch ist vielleicht gottesfähig, aber nicht jeder fühlt sich gottesbedürftig.
Was heißt das konkret?
Ich arbeite ja in Holland, und da haben wir neue Theologie-Studenten, die sind ohne Gottesbezug erwachsen geworden. Die stellen jetzt als Studierende allerdings Fragen und wollen dazulernen, und wir merken: Da ist offenbar eine Art „Gottes-Gen“ aktiviert worden. Es ist eine große Freude, das zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass es einen Automatismus gibt, dass das bei jedem Mensch so wäre, dass man nur den Schalter suchen muss.
Ich habe keine bessere Hoffnung gefunden als die christliche. Ich bin aufgehoben, versöhnt.
Was sagen Sie jetzt denen, die sagen: Wir müssen einfach nur die Ärmel hochkrempeln, Strukturen verändern, Neuevangelisation betreiben … dann wird das schon?
Wir hätten es gerne so: ich optimiere und dann kommt dies und das raus. Die 1:1 Rechnung geht nicht auf, weder in progressiver noch in konservative Richtung. Das funktioniert auch gnadentheologisch nicht, den Gott entscheidet, wann er wirkt und wann nicht. Was ich für mich in diesen Diskussionen entdeckt habe: Es geht auch um Identität. Die Frage der Menschen ist heute nicht mehr, wie kann ich mich – etwa vom Glauben oder von der Kirche befreien, sondern:Wer bist du, wer willst du sein. Dort wo ich weiß, was ich bekomme, bleibe ich, docke ich an. Dort wo Menschen identisch und auch authentisch etwas in der Kirche verkörpern, finden mancheMenschen auch heute noch eine Heimat.
Sie stellen den kirchlichen Aktivismus in Frage. Wie sind die Reaktionen darauf?
Auf Fortbildungen mit Seelsorgenden habe ich den Eindruck, dass die Anwesenden es ein wenig als Entlastung erfahren. Es ist für sie entlastend, wenn ich mit Zahlen und Fakten untermauere, was viele erleben und fühlen. Sie merken, sie haben erst mal nichts verkehrt gemacht. Nicht wir machen in erster Linie etwas falsch, sondern auch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Dies zu verdeutlich ist s ist auch das Anliegen dieses Buches.
Wer war denn am kritischsten?
Die Optimierer, also diejenigen, die daran glauben, dass man vor allem die bestehenden Angebote optimieren muss. Denen gefällt meistens die Radikalität meines Ansatzes nichtwirklich. Wir sind uns einig in der Analyse. Aber was wir danach dann tun, da geht es ein wenig auseinander. Ich habe mich aber gefreut, dass der Ansatz sowohl von Theolog:innen und pastoralen Kolleg:innen ernst genommen und diskutiert wird.
Zu ihrem Ansatz gehört der Satz: Lernt es, neu Fragen zu stellen. Welche denn?
Wir müssen vor allem erst mal verstehen, welche Fragen die Leute um uns rum haben. Das Thema Altern wird heute ganz anders gesehen, wenn in der Vorstellung eben nicht mehr der Himmel auf mich wartet. Das Thema Post-Kolonialismus, verbunden mit der Frage von Schuld und Vergebung. Dieselben Fragen wie früher werden auf einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Darin möchte ich wachsam dafür sein, wenn oder wo ein Gottes-Gen aufploppt und vielleicht auch wieder verschwindet.
Sie schreiben Religion wird „diverser, hybrider und pluraler“. Ist ein Wunsch, dass es so werden möge oder die These, dass es schon so ist? Und was heißt das für eine ganz normale katholische, evangelische oder freikirchliche Gemeinde vor Ort?
Wir haben die Eindeutigkeit ein bisschen sehr hoch gehalten. Gerade wir Katholiken mit den Konzilien oder in der Moderne. Heute brauchen wir ein bisschen mehr Leben in der Grauzone, in der Uneindeutigkeit. Ich liebe das Gleichnis von Jesus, wo er sagt: Lass das Unkraut und den Weizen aufwachsen. Reiß nicht vorzeitig irgendwas raus, du könntest auch den Weizen rausziehen. Und vielleicht hängen die Wurzeln noch aneinander. Lass es erst mal wachsen.
Grauzonen?
Ja, diese Graubereiche sollte man auch nicht heilig sprechen, aber sie sind nun mal da. Manche kommen zum Weihnachtsliedersingen, manche wollen nur den Segen haben – es ist alles nicht so eindeutig, wie wir es gerne hätten und idealisiert haben.
Sie schreiben, dass es keinen Grund zur Resignation gibt. Ich zitiere mal: „Es gibt keinen Grund, resigniert zu denken, Gott sei heute überhaupt nicht mehr zu finden oder unwirksam. Der Clou scheint zu sein: Er ist auf andere Weise und woanders präsent.“ Meinen Sie damit: jenseits der Kirchen?
Ich würde mich nicht auf eine Entweder-Oder-Konstellation einlassen. Ich geh nochmal in die Niederlande. Die Leute machen ihre Gotteserfahrungen, ihre Bekehrungserfahrungen, die nennen das auch so, aber sehr unterschiedlich. Die einen finden das über Social Media, die anderen werden mitgenommen in Gebetsgruppen und die dritten fangen an zu studieren, weil sie Thomas von Aquin lesen wollen. So unterschiedlich sind die Wege. Das ist manchmal komplett unabhängig von den klassischen Kirchen, aber es gibt in der Regel ein Rückbindungsbedürfnis an eine wie auch wir immer geartete Erzählgemeinschaft. Bei meinen Studenten in Utrecht merke ich, dass sie kompetente Auskunft haben möchten, und dann wird die Kirche in einem weiten Sinne wichtig.
Sind sind Priester, hoffnungsvoll auf der einen Seite. Aber auch mit vielen Fragen. Wie leben Sie Ihren Alltag in diesem Zwiespalt?
Ich habe keine bessere Hoffnung gefunden als die christliche. Ich bin aufgehoben, versöhnt. Die Hoffnung, meinen Vater, der vor kurzem gestorben ist, wieder zu sehen. Für mich gibt es keine Alternative, was die Hoffnung angeht. Das ist meines Erachtens die beste Hoffnung, die man haben kann, wohl wissend, dass das nicht mehr so viele teilen. Man ist dann eben eine „singuläre Existenz“, und ist für viele mit dieser Einstellung, diesem Glauben, auch ein Exot.
Wie hat Kirche für Sie Zukunft?
In der Kirche braucht es wieder einen Erzählraum für Geschichten. Klar braucht es auch Argumente, Bekenntnisse, das kritische Hinterfragen. Doch die Andockpunkte sind wie bei Jesus auch Gleichniserzählungen und das Teilen von Versöhnungs- und Hoffnungegeschichten.
Sie schreiben von ihrem Wunsch nach einer heruntergekommenen Kirche.
Ich wünsche mir Nähe und mehr Bodenhaftung. Das hat Jesus uns vorgelebt. Ich mache mal an einem Beispiel deutlich, was mich stört. 1000 kirchliche Hauptamtliche aus dem Bistum Münster arbeiten den Missbrauch auf. Alle Bischöfe kamen alle mit dem 5er BMW und dem Fahrer. Das geht so nicht mehr. Die wohnen in Münster, warum kommen die nicht mit dem Fahrrad? Heruntergekommene Kirche, das heißt für mich auch, dass wir Statussymbole aufgeben. Man lässt sich in Deutschland noch die Illusion eines flächendenken Christentums doch gut bezahlen. Die Herrlichkeit der 50er ist vorbei. Zudem werden Menschen zukünftig nicht mehr durch die Familie in die Kirche hinein geboren. Gott gibt nicht seine Göttlichkeit, aber seinen Status auf (Philipper 2). Darum geht es.
Sie wünschen sich eine demütigere Kirche?
Ja in dem Sinne: Kann man an unserem Lebensstil ablesen, dass der Glaube eine Bedeutung für uns hat?
Sie beschließen Ihr Buch mit einem Gedanken von Karl Rahner. Warum?
Weil er für mich programmatisch ist. Im 19. Jahrhundert galt im katholischen Bereich der Glauben als das Bollwerk gegen die Moderne. Anfang des 20. Jahrhunderts propagierte die Bewegung um Romano Guardini, dass die Kirche in den Seelen der Menschen erwacht, dass die Menschen merken: Hey, wir sind selber Kirche. Hier grätschte Karl Rahner auf dem Zweiten Vatikanum rein. Nein, es geht nicht um die Kirche, sondern um Christus als das Licht der Welt. Die Funktion der Kirche ist es, auf ihn hinzuweisen, Möglichkeiten zu schaffen, damit Gott Menschen berührt. Meine These ist: Wir haben diesen Paradigmenwechsel noch nicht verstanden. Wir arbeiten immer noch als Optimierer an der Kirche, statt die Gottesfrage in den Mittelpunkt zu stellen. Wir müssen Kirche von der Frage her denken: Wo wirkt Jesus Christus in ihr und durch sie. Wo wird sie – katholisch gesprochen – zum Sakrament der Gottesbegegnung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führten Rüdiger Jope (Chefredakteur vom Kirchenmagazin 3E) und Martin Gundlach (Chefredakteur AUFATMEN).
Jan Loffeld ist Professor für Praktische Theologie in Utrecht. Der Priester ist Berater der Deutschen Bischofskonferenz. Sein Buch „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz“ erschien 2024 im Herder Verlag.
AUTORIN · AUTOR

Rüdiger Jope (Jg. 1969) ist gebürtiger Sachse, aufgewachsener Hesse, eingeheirateter Schwabe und heimatgewordener Westfale. Der gelernte Werkzeugmacher, studierte Theologe und Sozialpädagoge verantwortet als Chefredakteur im SCM Bundes-Verlag das Kirchenmagazin 3E und das Männermagazin MOVO „Was Männer bewegt. Was Männer bewegen“. Der Freizeitläufer lebt zusammen mit seiner Frau Ingrid und den zwei Kindern in Wetter/Ruhr.

Die gute Seilschaft: hak’ Dich ein!
Dir gefällt BASECAMP?
Dann werde Teil unserer Community!
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!