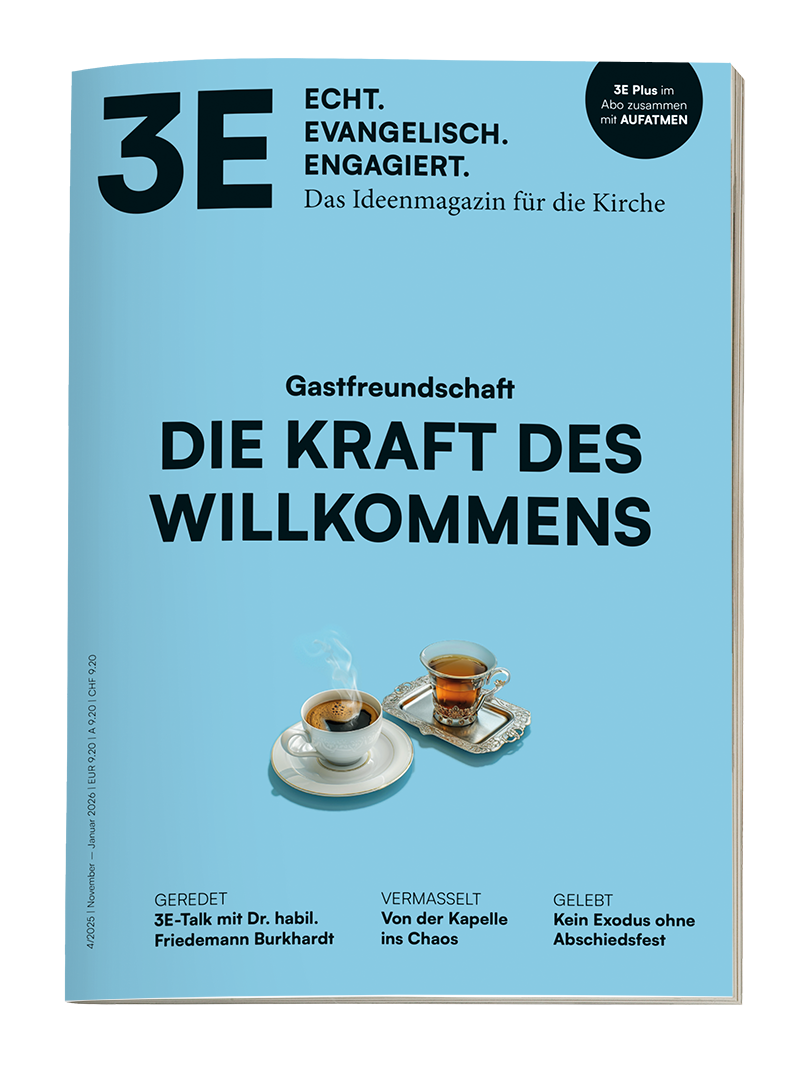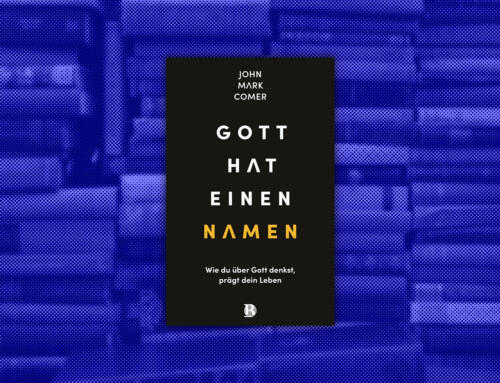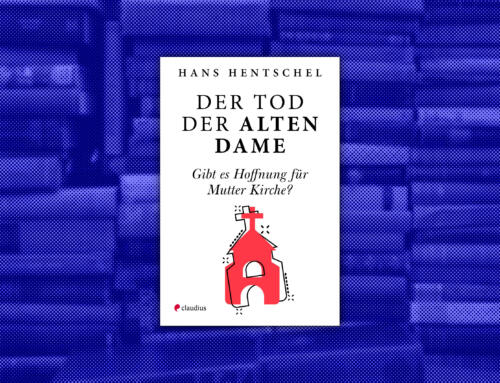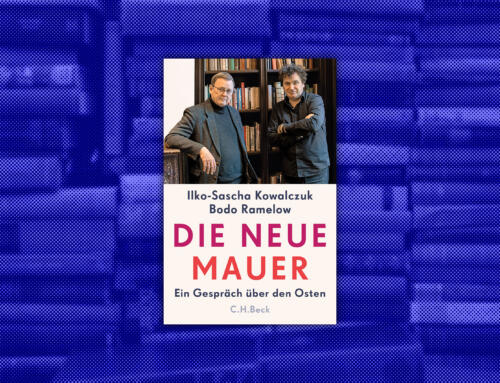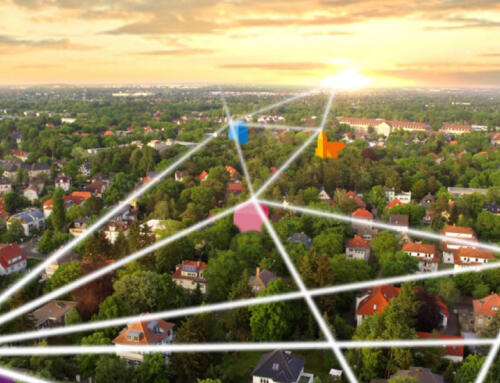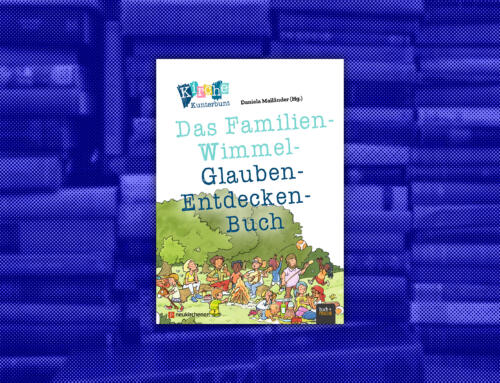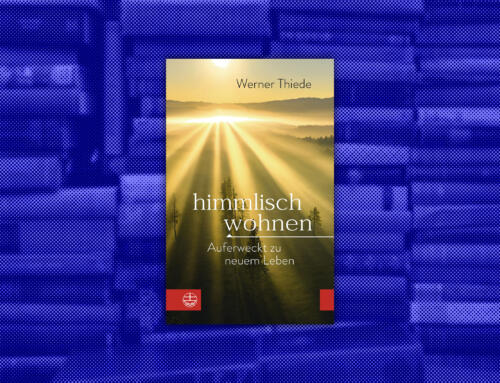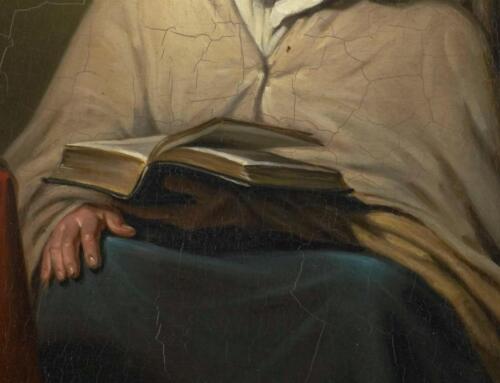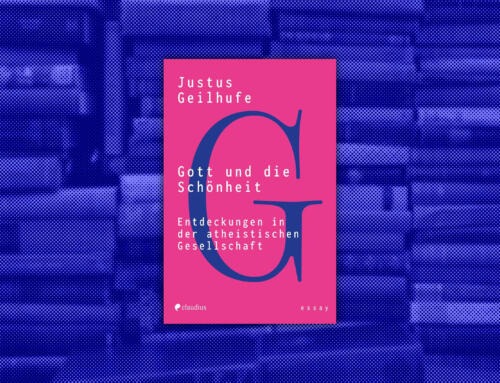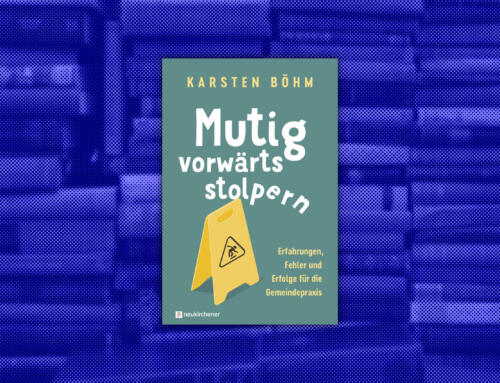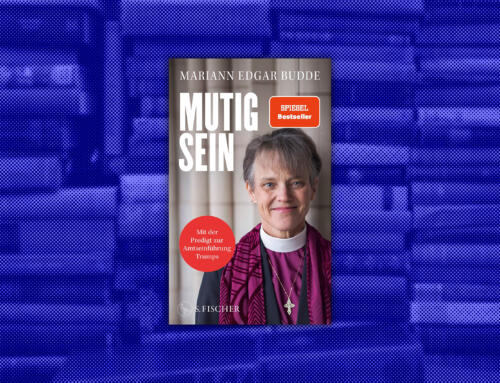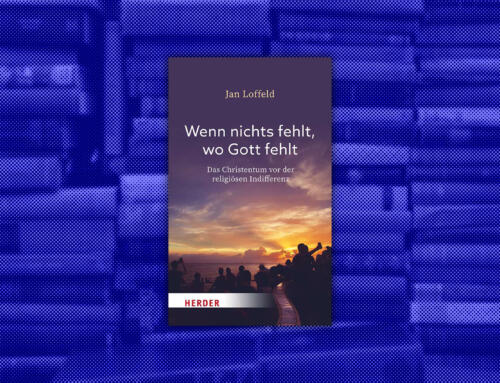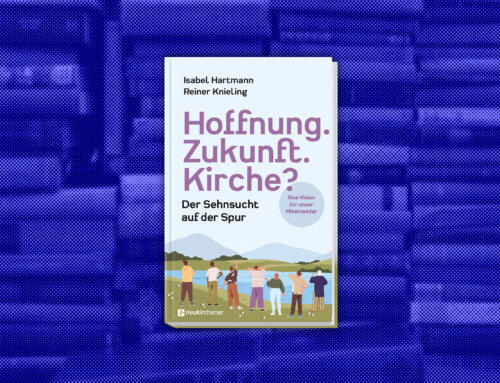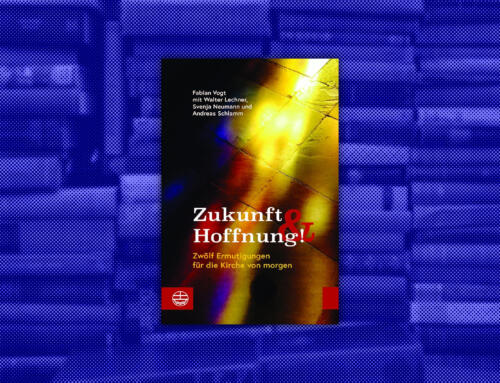Mehr Vielfalt bitte!
Mehr Vielfalt bitte!
VON Dr. Steffen Bauer
Wie halten wir es zukünftig mit dem Gottesdienst? Wie wollen wir ihn feiern? Sollte mir ihn ganz abschaffen? Nein! Ein Beitrag zur „Christ und Welt-Diskussion“.
Es gibt Diskussionen, die kehren immer wieder. Es gibt Fragen, die werden offenbar nie endgültig geklärt. Im Mai 2024 war es wieder so weit. Da schrieb Pfarrerin Hanna Jacobs einen Artikel in „Christ und Welt“ mit der Überschrift „Schafft den Gottesdienst ab“ und kritisierte darin den „normalen“ Gottesdienst am Sonntagmorgen. Zuviel Aufwand für zu wenig Resonanz würde dort an vielen Stellen betrieben. Ihr Plädoyer lautete dagegen, die Ressourcen doch besser für andere Aktivitäten der Kirche zu nutzen. Der Aufschrei war groß. Dabei, wer den Artikel bis zu Ende gelesen hatte, dem fiel es auf: Hanna Jacobs sprach davon, dass der Aufwand für den Sonntagsgottesdienst in der klassischen Form durchaus noch lohne, wenn 50 oder mehr Menschen ihn feiern würden, aber nicht mehr, wenn er zu einer traurigen Veranstaltung für eine kleine, eine sehr kleine Schar geworden sei.
Wer ist das „Wir“?
Auf dieser Basis lässt sich dann schon besser diskutieren. Nicht abschaffen, sondern darüber ehrlich diskutieren: Wie wollen wir es mit dem Gottesdienst halten? Wie wollen wir ihn feiern? Wann und wo wollen wir ihn feiern und vor allem: Wer ist eigentlich das „Wir“?
Szenenwechsel, selber Monat und wieder große Aufregung um den Gottesdienst: Über 1.000 Menschen nahmen an den beiden sogenannten „Taylor Swift Gottesdiensten“ an einem Sonntag in der Heiliggeistliche in Heidelberg teil. Die einen waren begeistert, selbst die internationale Presse stürzte sich darauf, und andere rümpften die Nase. Darf so ein Gottesdienst sein? Verkommt der Gottesdienst so nicht zu einer reinen Event-Kultur? Wollen wir den Sonntagsgottesdienst etwa so haben? Auch hier lohnt sich der Blick hinein in das Geschehen. Da werden Texte von Taylor Swift zitiert, die sich kritisch mit der oberflächlichen Konsumgesellschaft zu Weihnachten auseinandersetzen und der Titel: „Christmas Must Be Something More“ gesungen. Da werden Kernbotschaften des christlichen Glaubens in anderer Form und in Worten, Texten und Lieder einer wahrhaft erfolgreichen Sängerin gebetet, vorgelesen, meditiert, ins Leben gebracht und wer eine der kostenlosen Karten reservieren wollte, musste schnell sein, denn nach kurzer Zeit waren die beiden Gottesdienste schon Wochen vorher „ausverkauft“, ja auf der Hauptstraße bildete sich eine Schlange von Menschen, die diese beiden Gottesdienste besuchten. Darunter waren ganz, ganz viele Mädchen, Jugendliche, die sogar ihre Mütter mitgebracht hatten (so sah das wirklich aus).
Und auch hier wieder die Fragen: Wie wollen wir es mit dem Gottesdienst halten? Wie wollen wir ihn feiern? Wann und wo wollen wir ihn feiern und vor allem: Wer ist eigentlich das „Wir“?
Wir brauchen Mut zum Ausprobieren
Ich lese schon im Neuen Testament von einer Vielzahl an Formen, Orten, Gelegenheiten zur Verkündigung. Entscheidend dabei ist die Frage, ob der Inhalt bei den Zuhörenden, bei den Feiernden, bei den Mitmachenden ankommt, ob sie erreicht werden. Und die Voraussetzung für diese Vielfalt ist das „Dürfen“, der Mut zum Ausprobieren mit dem Wissen um die Verschiedenheit der Menschen von damals.
Genau dieses Wissen, genau diesen Mut wünsche ich mir heute für alle, die beim gottesdienstlichen Geschehen in Vorbereitung und Durchführung mitmachen. Nur so werden wir die eine Form nicht gegen andere ausspielen, nur so werden wir sowohl das „Alte“ und „Bewährte“, aber auch das „Neue“ und das „Ausprobieren“ schätzen und zulassen. In meiner Wahrnehmung blockiert das eigene Verständnis vom „Gottesdienst“ mitunter das Zulassen neuer und anderer Formen, Orte und Zeiten. Überspitzt formuliert: Nur so wie ich Gottesdienst feiern möchte, soll er auch gefeiert werden. Und genau diese Einstellung engt ein, macht den Gottesdienst oft milieuverengt was Sprache und Musik, was Liturgie insgesamt, aber eben auch was Form, Zeit und Ort angeht.
Die Realität sieht aber – Gott sei Dank – oft schon ganz anders aus: Aus einem „zweiten Programm“ sind an vielen Orten seit vielen Jahren schon gleichwertige und deutlich voneinander unterschiedene Gottesdienstformen geworden. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch befördert, denn jetzt wurden Formate an anderen Orten und zu anderen Zeiten verstärkt ausprobiert. Die digitalen Gottesdienste kamen dazu. Ich bin der festen Überzeugung, dass genau diese Diversität weiter zunehmen wird und auch zunehmen sollte.
Ich selbst gehöre wahrscheinlich zum eher klassischen Typus „Gottesdienstgänger“. Eine gute (!) Predigt darf für mich ruhig länger als 20 Minuten dauern und der Gottesdienst sollte für mich nicht vor 11 Uhr beginnen. Ich gehöre damit wahrscheinlich eher zu einer Minderheit. Nun bin ich aber bereit, durchaus viele Kilometer zu fahren, um solch einen Gottesdienst mitfeiern zu können. Entscheidend für mich ist dann „nur“, dass ich an die entsprechenden Informationen komme, dass ich digital nachschauen kann, was mich wann wo erwartet, worauf ich mich wo und wann einlassen kann, worauf ich mich wo freuen darf. Die Feier des Gottesdienstes, und das wird, so glaube ich, zunehmen, ist für mich nicht an meinen Wohnort gebunden. Gottesdienstliche Gemeinde sammelt sich um ein Geschehen herum, bildet sich, ereignet sich. Gerne akzeptiere ich, wenn andere das nicht so sehen und z.B. ihr eigenes Kirchengebäude beständig brauchen. Das ist eben Teil der Vielfalt. Die eigene Ansicht auf alle zu übertragen, das ist für mich problematisch.
Diversität wagen
Noch ein letztes ist mir wichtig: Wer wie wo und wann Gottesdienst feiert, das kann man nicht von außen vorschreiben, sondern liegt allein in der Entscheidungsbefugnis vor Ort. Die Verantwortlichen vor Ort wissen am besten, was der Verkündigung dient. Allerdings sollte diese Entscheidung mehr und mehr mit anderen in der Region abgestimmt und wenn möglich aufeinander bezogen werden. Das ist die große Lernerfahrung, die es jetzt überall zu machen gilt. Für mich bietet die sogenannte „Regio-Lokale-Kirche“ die Chance, einerseits lokale Besonderheiten zu leben und andererseits sich regional abzusprechen, die Vielfalt zu leben und auch wechselseitig zu bewerben. Übrigens: Gerade weil es immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, wird die ehrenamtliche Verkündigung immer wichtiger und gehört zur größeren Vielfalt immer mehr dazu. Auch darüber freue ich mich.
Pfarrer Dr. Steffen Bauer leitete bis Ende August 2024 die Ehrenamtsakademie der EKHN und war vorher 15 Jahre Gemeindepfarrer und 7 Jahre Dekan von Heidelberg.
Foto von Terren Hurst auf Unsplash
AUTORIN · AUTOR

Dr. Steffen Bauer war Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelische Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN). Er ist Autor des Buches „Kirche der Menschen – zuversichtlich, mutig, beidhändig ermöglichen“ (Verlag Hartmut Spenner).
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!