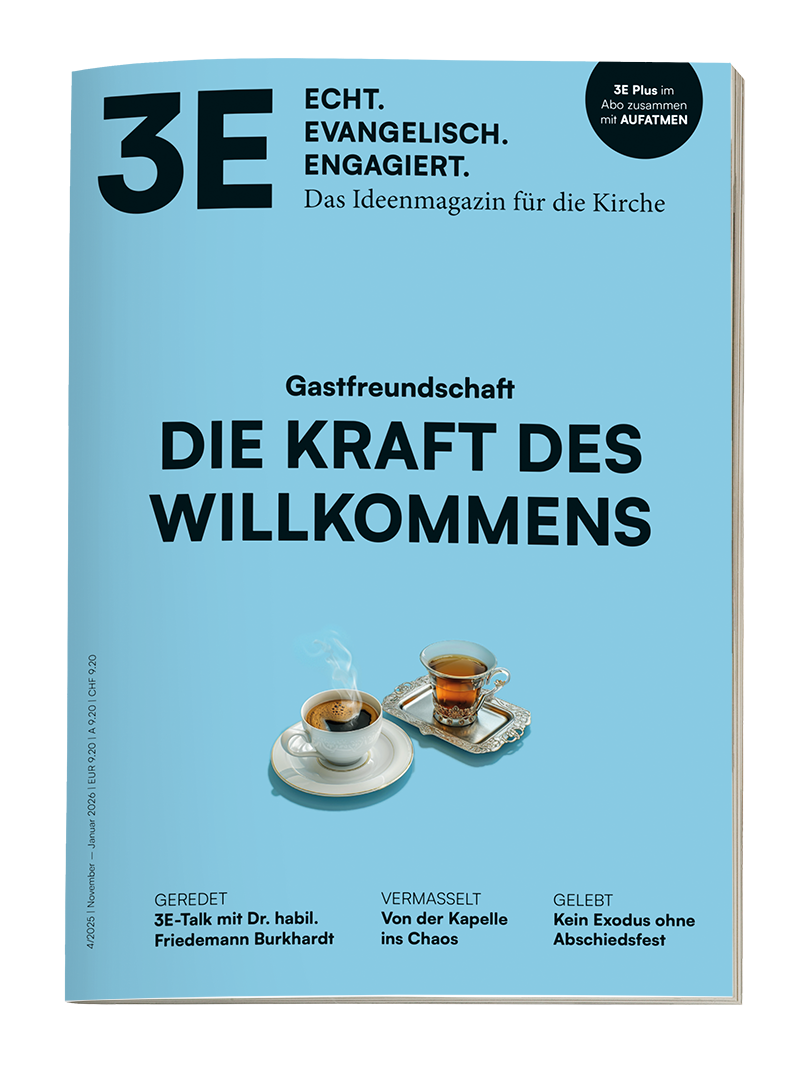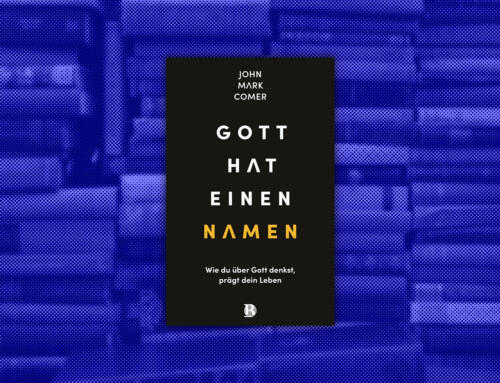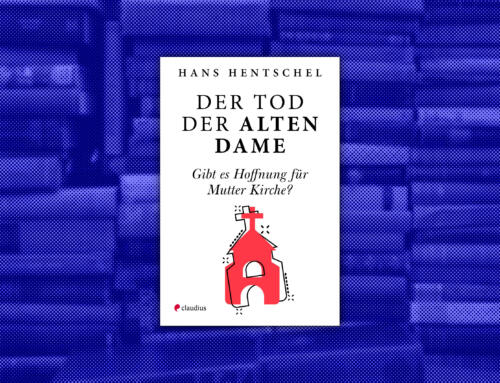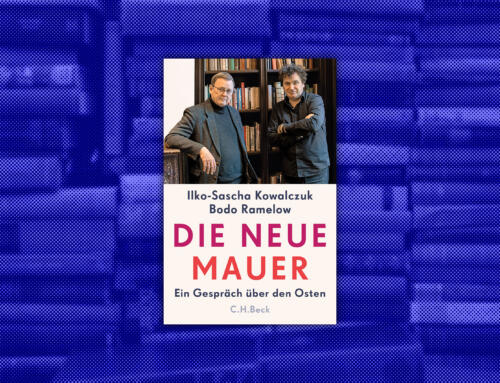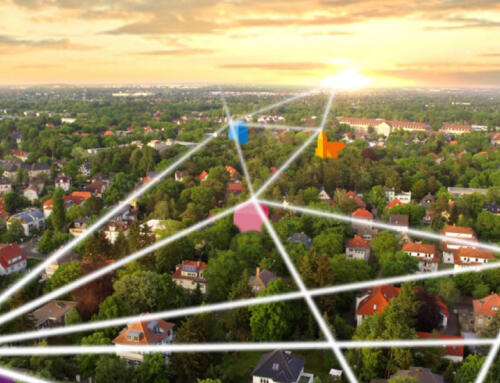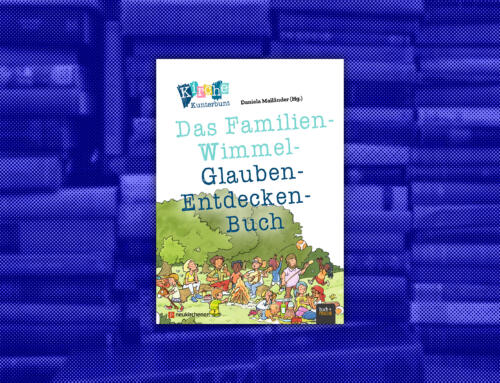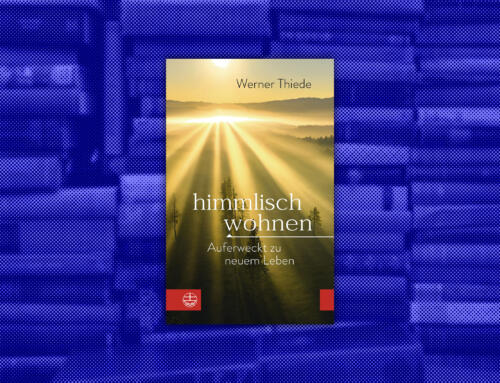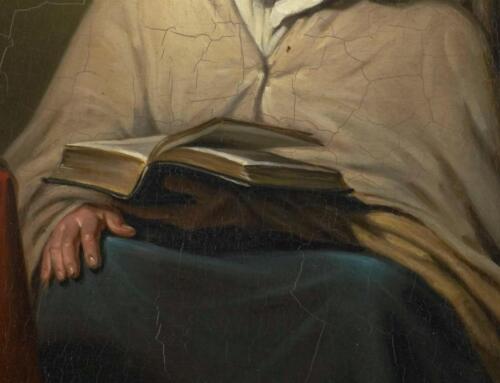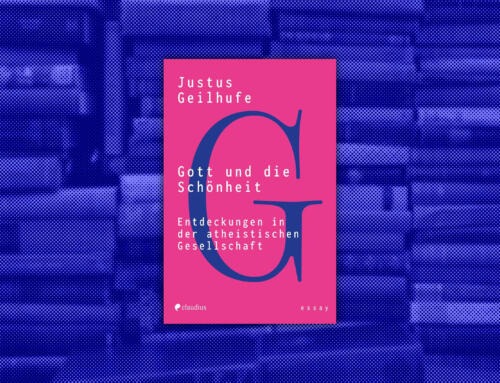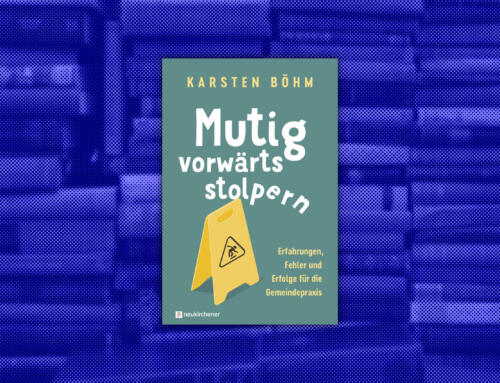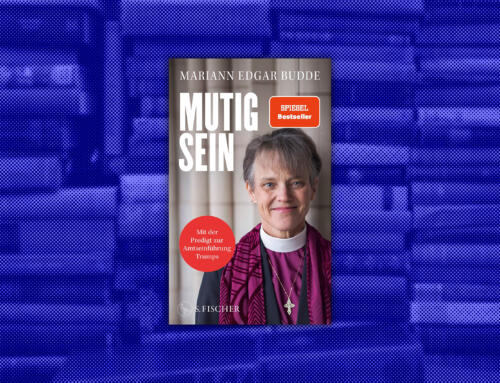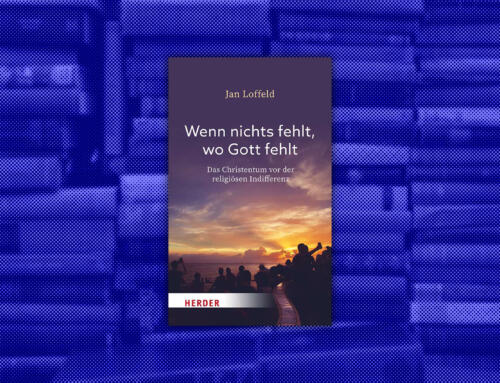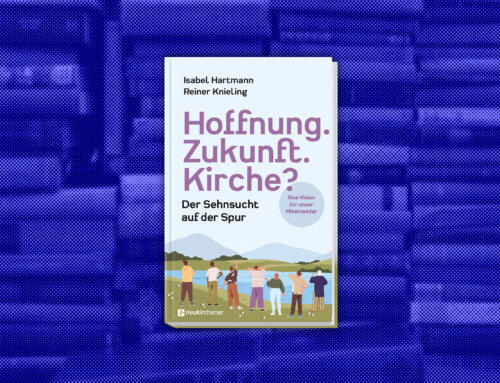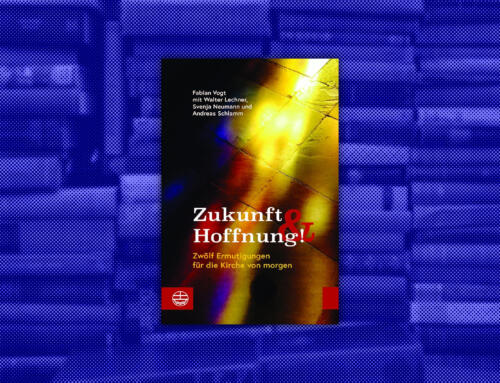Design oder Desaster?
Design oder Desaster?
VON Dr. Steffen Bauer
Antwortversuch auf die Veränderungswege, in denen wir als Kirche stecken
Meine Überzeugung ist: Je stärker wir uns geistlich erneuern und strukturell vereinfachen, desto lebendiger wird die Kirche. Deshalb versuche ich nicht nur Veränderungsprozesse in den Landeskirchen wahrzunehmen, sondern nehme mir auch das Recht heraus, diese einzuordnen, miteinander zu vergleichen, sie auf Zukunftstauglichkeit hin zu befragen, von daher zu bewerten und eigene Zukunftsbilder zu beschreiben. Vor allem zu meinen Einschätzungen, Bewertungen und den eigenen Zukunftsbildern erreichen mich immer wieder ganz wichtige, auch kritische Anfragen. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:
- Kann Kirche sich überhaupt in solch einem Ausmaß transformieren, wie ich das aus meiner Sicht als notwendig beschreibe?
- Haupt- und Ehrenamtliche vor allem aus den Bereichen der Gemeindearbeit vor Ort fragen: Was kann ich dazu beitragen, dass es so werden könnte? Wie kann ich hilfreich sein?
- Pfarrerinnen und Pfarrer fragen nach der Bedeutung des Pfarramtes, des Pfarrberufs in der Zukunft. Kann man noch guten Gewissens dafür werben, Pfarrerin oder Pfarrer werden zu wollen?
Unabänderlich. Die Transformation kommt!
Kirche wird sich in jedem Fall transformieren. Die Frage lautet nur noch, ob by Desaster oder by Design? Durch bestimmte Ereignisse in den letzten Monaten ist bei mir die Zuversicht gewachsen, dass die Organisation Kirche zu allem in der Lage ist, wenn es gilt, eine „Transformation by Desaster“ gerade noch abzuwenden (Evangelische Kirche in der Pfalz). Jetzt aber müssen alle Kirchenleitungen für sie ganz schwierige Schritte gehen und vor allem Macht abgeben, die „Spielräume“ vor Ort deutlich erweitern und gleichzeitig (!) die landeskirchliche Struktur verändern. Daneben kann ich wahrnehmen: Eine „Transformation by Design“ wird immerhin an ersten Orten sichtbar. Haupt- und Ehrenamtliche der Kirche können ganz viel zum Gelingen der Transformation beitragen und zwar auf allen Ebenen von Kirche, indem sie z.B.:
- Menschen an vielen Orten verstärkt zuhörend begegnen;
- neu miteinander (!) nach dem (geistlichen) Auftrag von Kirche fragen, so nach vorläufigen Antworten suchen und sie zum Leben bringen;
- das Miteinander gerade in der Regio-Lokalen Kirche stärken;
- von den Leitungen Klarheit über die voraussichtlichen Rahmenbedingungen einfordern und sich nicht (mehr) mit vagen Andeutungen zufriedengeben;
- von der landeskirchlichen Ebene ähnliche Schritte erbitten, wie sie in der Regio-Lokalen Kirche schon gegangen werden.
Im Wandel die Chance ergreifen
Der Pfarrberuf wird sich weiter wandeln. Genau darin liegen große Chancen, aus meiner Sicht sogar Verheißungen für großartige Berufsaussichten für gut ausgebildete Theologinnen und Theologen als Teamplayer in einer Kirche der Menschen. Doch kann Kirche die Transformation? Ja! Mein „Ja“ begründe ich mit zwei Wahrnehmungen bzw. unmittelbaren Erfahrungen.
- Kirche kann Transformation, weil das bisherige parochiale Denken (=„meine Gemeinde, meine Kirche, mein Gemeindehaus, mein Pfarrer….“) nicht mehr fortgeführt werden kann.
- Und Kirche kann Transformation, weil Verantwortliche das bisherige parochiale Denken nicht mehr fortführen wollen.
Die zentrale Frage der Kirchenentwicklung lautet: Wie wollen wir Kirche sein?
Ich erlebe Veränderungsprozesse in der Kirche im Moment vor allen Dingen in drei Bereichen, und die betreffen die Kirche vor Ort, in der Region, den Kirchenkreis, die Dekanate, die Kirchenbezirke, wie immer diese Ebenen auch genannt werden:
- Überall werden multiprofessionelle Teams gebildet;
- die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden in einer Region wird mehr oder weniger verbindlich vorgeschrieben und geregelt;
- durch andere Verwaltungsstrukturen sollen Haupt- und Ehrenamtliche entlastet werden.
Diese Bewegungen finden sich fast überall und immer geht es um eine Stärkung einer Regio-Lokalen Kirche. Ich selbst sehe in diesen drei Veränderungen nicht eine Fortführung des bisherigen parochialen Denkens ausgeweitet auf eine größere Fläche, sondern zumindest die Möglichkeit, dass diese Entwicklung eine tiefgreifende Veränderung der Haltungen und damit der Kultur und der bisherigen Struktur einschließlich der Leitungsebenen bedeutet und damit eine wirkliche Transformation darstellt.
Wer zu spät kommt …
Leider geschieht auf dieser Ebene die Transformation nur, wenn die Not schon groß geworden ist. Das bisherige System kann aus Ressourcengründen einfach nicht mehr aufrechterhalten werden. Im letzten Moment versucht man so die „Transformation by Desaster“ zu verhindern. Dieses Verhalten sieht man besonders gut in der Landeskirche der Pfalz. In einem regionalen Beitrag in der Rheinpfalz stand als Überschrift über ein Interview mit einem Dekan zu lesen: „Die Landeskirche geht All in“. Und genau das ist es, was in der Pfalz passiert. Ich behaupte, dass dort vor zwei Jahren noch kein Gedanke daran war, dass man z.B. die Zahl der Körperschaften des öffentlichen Rechts um 99 Prozent und die Zahl der Dekanate um 75% verringern müsse, um die Kernaufgaben von Kirche auch in 10 Jahren noch finanzieren und ausführen zu können. Genauso wird dort aber die Situation beschrieben und diese Notlage setzt die Transformation in der gesamten Struktur, der Kultur und auch in der Leitung in Gang1 .
Ich halte diese Veränderungen grundsätzlich für richtig und für wichtig, aber zum Teil kommen sie zu spät. Prozesse in der Kirche sind langwierig. Ich selbst habe im Jahr 2015 zum ersten Mal von der Bildung von Nachbarschaftsräumen mit der Errichtung von Regiogemeinden, von Teams und von einer Geschäftsführung für die Verwaltung geschrieben2 und damals das Jahr 2025 als Jahr der Einführung genannt. Sie würden jetzt in der Tat dringend gebraucht.
Die Motivation zu einer Transformation kann aber auch anders begründet sein. Im inzwischen sehr bekannten Modell aus Pforzheim (Aufgabe der Kirchengemeinden des kirchlichen Rechts einschließlich Abschaffung der dafür eingerichteten „Ältestenkreise“ und Errichtung von fünf neuen Leitungsorganen, die jeweils für ein Themengebiet zuständig sind…) war einer der mindestens acht von mir wahrgenommenen Erfolgsfaktoren ein Hinhören auf völlig verschiedene Menschen überall in Pforzheim. Dieses Zuhören und Hinhören, verbunden mit einem danach erfolgten intensiven neuen Fragen nach der (geistlich-theologischen) Aufgabe von Kirche in diesem Dekanat, hat zu einem neuen Modell geführt, das für mich die Kennzeichnung als „Transformation by Design“ verdient. Die zuständige Stadtsynode hat sich nach intensiven Diskussionen zu diesem großen Schritt entschieden und mit einer Mehrheit von 80% in geheimer Wahl gesagt: So wollen wir in Zukunft Kirche sein3 . Kirche steht also in jedem Fall inmitten einer Transformation und alle können dazu beitragen, dass es eine „Transformation by Design“ wird.
Raus aus dem Einzelkämpfertum
Aus meiner Sicht ist es für jede engagierte Person in der Kirche möglich, ja geboten, zum Gelingen der Transformation beizutragen, und zwar:
- an dem Platz, an dem „Ich“ mich befinde, indem „Ich“ die Regio-Lokale Kirche stärke;
- als Anfrage an die Leitungen: Sorgt für klare Rahmenbedingungen, legt alle verfügbaren Erkenntnisse auf den Tisch und schaut selbst über eigene Begrenzungen hinaus.
Die Zusammenarbeit von Menschen, Gemeinden, Werken, Diensten, Einrichtungen will mehr denn je eingeübt werden. Jegliche Form des „Einzelkämpfertums“ und des nur eigenen „Kirchturmblicks“ ist für alle Beteiligten vorbei.
Die zentrale Frage der Kirchenentwicklung: „Wie wollen wir Kirche sein? lässt sich aus meiner Sicht nicht mehr für eine Parochie allein beantworten, sondern gehört in der Regio-Lokalen Kirche gestellt. Für mich werden 2040 rund 400 Kirchenkreise mit je 25.000 Gemeindeglieder die entscheidende Bezugsgröße sein und das gilt es heute schon bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Hilfreich bei der Bildung dieser Kirchenkreise ist eine Orientierung an der Größe der Landkreise bzw. der Städte. Sie sind das „natürliche“ gesellschaftliche Gegenüber. Für mich macht es auch Sinn, wenn in Regionen und Städten heute schon angestrebt wird, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts auf diese Größenordnung bezogen zu entwickeln. Solche Kirchenkreise brauchen aber eine hohe Selbstwirksamkeit, große Entscheidungsbefugnisse und weite Ermöglichungsräume. Dort, als Kirche mittendrin, sozialraum- und netzwerkorientiert, in bester (und weit gefasster) ökumenischer Kooperation ist die Frage zu stellen „Wie wollen wir Kirche sein?“ Und aus den Antworten erwachsen dann z.B. inhaltlich begründete, notwendige und sicher auch schmerzhafte Gebäudeentscheidungen. Ganz sicher nicht sollten Gebäudefragen nur mit einem Blick auf die bisherige Parochie angegangen werden.
Ausprobieren statt ausgebremst werden
In den Körperschaften des kirchlichen Rechts, d.h. gerade in Dörfern, bisher kleinen Gemeinden und Gemeinschaften, aber eben auch in den Stadtteilen und Quartieren braucht es vor allem Ehrenamtliche, die geistliches und gemeinschaftliches Leben vor Ort gestalten. In den Entscheidungsorganen der (großen) Körperschaft des öffentlichen Rechts braucht es die Haltung der Unterstützung dieses Lebens, der Förderung, der Ermöglichung. Wenn und wo diese Haltung gelebt wird, wird man vor Ort froh sein, wenn möglichst viele Verwaltungsvollzüge und Verantwortlichkeiten auf dieser anderen Ebene gewährleisten werden und man selbst frei davon ist. Kirche wird so mehr denn je davon leben, sich in der Region wechselseitig und das Gemeinwesen tiefer kennenzulernen, Lebens-, Glaubens- und Gotteserfahrungen hörbar zu machen, Diakonie, Seelsorge, Gemeinschaft zu stärken. Wir müssen wegkommen von: „Das geht nicht“ und hinkommen zu: „Wir probieren es aus“, „Wir lassen es ausprobieren“, „Wir lassen machen“. Alle, wirklich alle können ihren Beitrag dazu leisten. Das Einüben braucht Zeit, Mut, wachsendes Vertrauen. Es braucht die Abgabe von Zuständigkeiten und Macht, damit man mit neu gewonnener Freiheit und der Unterstützung von Leitung und Verwaltung ins neue Gestalten kommt.
Wir müssen wegkommen von: ‚Das geht nicht‘ und hinkommen zu: ‚Wir probieren es aus‘!
All das und vieles mehr gehört für mich zur „Kirche der Menschen“4 . Es geht um eine sich verändernde Haltung, um eine neue Struktur mit der Entlastung von Haupt- und Ehrenamtlichen und eben auch vor allem um ein stärkeres Fragen nach dem Auftrag von Kirche, nach dem „Warum“ und „Wozu“, nach der geistlichen Ausrichtung. In meiner Sichtweise bezieht dieses Fragen immer sowohl alle Menschen in der Region ein als auch auf ein Fragen nach Gott in dieser Zeit und in dieser Welt an diesen Orten5 .
Im Nachbarschaftsraum „Arnsburger Land“ hat man sich auf den Weg gemacht, zum 1.1.2026 aus zehn Kirchengemeinden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu machen. Man hat sich der Frage „Wie wollen wir Kirche sein?“ gestellt und antwortet darauf mit einem Dreiklang: „Glauben leben, Menschen verbinden, Hoffnung schenken“ – so will man dort Kirche sein. Das Logo stellt das Kreuz als bunte Vielfalt dar, wobei jede Farbe für eine bisher selbständige Kirchengemeinde steht. Und wer die Homepage aufruft, der wird sehen, dass die zehn Fäden auf der Landkarte auf diese zehn geistlichen Orte, an anderen Orten würde man sie als Körperschaften des kirchlichen Rechts bezeichnen, auch verweisen6 . Gemeinsam Neues zu beginnen und gleichzeitig nach zu bewahrender Identität zu fragen, gehört zur geistlichen Ausrichtung dort dazu. Ich empfinde das als sehr gelungen.
Gefragt sind Mut und Transparenz
Damit Transformation umgesetzt werden kann, braucht es klare Rahmenbedingungen und vorher Kirchenleitungen, die umfassend über die Lage informieren. Prognosen sind immer mit großer Unsicherheit behaftet und weitere Veränderungen können sich im Prozess einstellen. Aber nur dort, wo jetzt alle Entwicklungen und vorhandenen Zahlen auf den Tisch gelegt werden, können weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Das aber ist bei weitem noch nicht in allen Landeskirchen der Fall, leider. Es ist aus meiner Sicht jetzt Aufgabe von allen, die es gut mit der Organisation Kirche meinen, Leitungen danach zu fragen, nicht locker zu lassen und sich nicht vorschnell abwiegeln zu lassen. Wo umfassend informiert wird, geraten mindestens 10 Jahre in den Blick und wird gleichermaßen – so geschieht es in Sachsen – daran erinnert: Auch danach geht es mit Ressourcenanpassungen weiter.
Mit Blick auf 2035 spricht die EKKW von 50% weniger an Finanzkraft; die Pfalz von 45%; Lippe von 37%; Sachsen von 34%. Damit ist das Tableau aber noch lange nicht hinreichend erfasst. Der (sehr junge!!!) Finanzdezernent von Württemberg hat im Verbund mit dem gesamten Oberkirchenrat in der Synode dort einen Finanzplan vorgelegt, der nicht nur das relativ geringe strukturelle Defizit dieser an Kirchensteuereinnahmen reichen Landeskirche geschlossen, sondern vor allem auch alle (!) jetzt absehbaren Verpflichtungen aus Versorgung und Beihilfe abgedeckt hat. Umso mehr rückt die Frage an alle Kirchenleitungen in den Mittelpunkt, wie, von wem und wann diese Kosten dort zu 100% in die Haushaltsplanung eingepreist werden? Der Einsparplan in Württemberg in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro in 12 Jahren ist in einem – wie ich finde – vorbildlichen Prozess diskutiert und schließlich mit großer Mehrheit in der Synode verabschiedet worden. Transparenz und Mut zahlen sich aus. Neben Württemberg haben auch die Pfalz und die EKKW genau das bewiesen. Andere müssen aus meiner Sicht schnell folgen.
Ein weiteres großes Thema ist die Frage der Finanzierbarkeit der Klimaschutzgesetze, die in den Synoden nach und nach beschlossen worden sind. Auch hier vermisse ich die Klarheit auf der Kostenseite. Die aber gehört dazu, um eine neue Glaubwürdigkeitslücke von Kirche zu verhindern. Klar muss sein: Jedes Abwarten und Verzögern dieser Klarstellungen vergrößert die Problemsituation. Deswegen ist es so wichtig, dass alle sich um diese Transparenz bemühen und sie einfordern.
Zehn Landeskirchen sind zukünftig genug!
Genauso braucht es ein von den Kirchenleitungen vorzulegendes Zukunftsbild der EKD mit ihren jetzt noch 20 Landeskirchen insgesamt. Es wird viele, viele Jahre brauchen, bis solch ein Zukunftsbild umgesetzt sein wird. Aber die Mehrfachstrukturen von heute, ein unabgestimmtes Nebeneinander, eine Vielstimmigkeit in so vielen auch grundlegenden Fragen der Organisation kann sich Kirche nicht mehr leisten. Es wäre gut, wenn die Frage „Warum tun wir das nicht mit anderen Landeskirchen zusammen“ zur neuen Selbstverständlichkeit werden würde. Gleichfalls wäre es gut, wenn der riesengroße Elefant im Raum bezüglich der Zukunftsfähigkeit der immer noch 20 Landeskirchen 80 Jahre nach Gründung der EKD offen (!) angegangen werden würde. Mit Blick auf den sich prozentual nach wie vor beschleunigenden Rückgang an Gemeindemitgliedern ist doch längst zu fragen, warum bestimmte Landeskirchen nicht in einem ersten Schritt in einer Zehnjahresfrist zusammengehen. Ich denke da an Rheinland und Westfalen und Lippe, EKHN und EKKW, Baden und Württemberg, Anhalt und die EKM, Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und die Reformierte Kirche. Die Pfalz (und Bremen?) würde sich zuordnen. Dann wären es noch 10 Landeskirchen.
In einem zweiten Schritt könnte dann neben der schon vorhandenen Nordkirche an die Bildung einer vereinigten Ost- (EKBO, EKM, Anhalt, Sachsen?), Süd- (Bayern, Baden, Württemberg?) und Westkirche gedacht werden. Darüber stünde dann eine neu zu erfindende EKD mit neuen Befugnissen und „darunter“ als Kern, als Mitte die sehr selbstständigen 400 Kirchenkreise mit je 25.000 Gemeindemitgliedern im Schnitt. Niemals mehr werden für diese Umbauten mehr Ressourcen zur Verfügung stehen als jetzt, das muss allen Verantwortlichen klar sein. Das in eine Zeit aufzuschieben, in der das Personal um 40 -50 % geringer sein wird als jetzt, öffnet einer Transformation by Desaster alle Türen.
Ja, das ist Zukunftsmusik, für manche klingt das nach Science Fiction und/oder verschroben. Aber das Entstehen solcher Bilder würde jetzt schon bei allen weiteren Überlegungen zur Zukunft aller Einrichtungen und Kirchenkreise und allen Fragen nach Angestellten, Beamten, Gehalts- und Verwaltungsstrukturen helfen. Aus meiner Sicht geht es darum, die Kirchenleitungen der Landeskirchen in eine besondere Form der Ambidextrie, eine Beidhändigkeit, in der Prioritätensetzung zu bringen: Auf der eine Seite sollte den Kirchenkreisen viel mehr Gestaltungsspielraum als heute mit je unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten gegeben und auf der anderen Seite die neue Organisationsstruktur auf EKD-Ebene als Transformation by Design jetzt angegangen werden7 . Meine Hoffnung ist, dass die Leitungen in diese Ambidextrie durch die Begleitung von vielen Haupt- und Ehrenamtlichen im Gebet, mit präzisen Fragen und einem Insistieren darauf hineinwachsen .
Eine Profession im Wandel8
Meine Hypothese ist, dass beim Pfarrberuf gerade jetzt mehr denn je die Möglichkeit besteht
- Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu korrigieren und
- lustvoller als in den letzten Jahrzehnten mit seiner theologischen Kompetenz wirksam zu sein.
In den sich abzeichnenden Veränderungen und noch mehr in meinem Zukunftsbild der Arbeit in den weitgehend autonomen Kirchenkreisen werden Haupt- und Ehrenamtliche durch neue Verwaltungsstrukturen entlastet und in ihrer Selbstwirksamkeit wesentlich gestärkt. Die Organisation Kirche hat gemerkt, dass gerade im Pfarrberuf in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Zeit für Aufgaben aufgewendet werden musste, die weder bei der Motivation, diesen Beruf zu ergreifen noch beim Erlernen dieses Berufs eine Rolle gespielt haben. Es ist gut, wenn dies nun anders wird. Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen und sollen keine Bau- oder Finanzfachleute oder gar Juristinnen und Juristen sein oder werden. In der Landeskirche von Braunschweig ist es jetzt sogar schon möglich, vakante Pfarrstellen umzuwandeln und z.B. Baufachleute anzustellen. Das ist richtig. Meine Prognose lautet, dass die theologischen Kompetenzen der Pfarrerinnen und Pfarrer in Zukunft wieder viel stärker zu Geltung kommen und auch in Anspruch genommen werden,
- weil das Einzelkämpfertum zum Ende gekommen ist und weil multiprofessionelle Teams überall entstehen, wird es zunächst darauf ankommen, dass dort viel über Gottes-, Glaubens- und Lebenserfahrungen geredet wird. Dieses Reden will eingeübt sein.
- weil die überall entstehenden Körperschaften des kirchlichen Rechts in den Tagesordnungen der Leitungen vor Ort viel mehr Zeit für Fragen der Kirchenentwicklung (Wie wollen wir Kirche sein?) haben werden, werden auch dort Theologie, Glauben, Spiritualität im Miteinander von Haupt- und Ehrenamt eine größere Rolle einnehmen. Auch dort will dieses Reden eingeübt sein.
- weil der Verwaltungsanteil in der täglichen Arbeit abnehmen und man als Teil des Teams viel stärker gabenorientiert wird arbeiten können, wird der Anteil von Verkündigung (in vielfältiger Form), Seelsorge, Bildung … zunehmen.
Die Zukunft liegt im Team
Ich bin überzeugt: Die Arbeitszufriedenheit wird steigen. Für diese Rahmenbedingungen eines Berufs darf gerne Werbung gemacht werden, zumal die Zahlen an den Universitäten so drastisch zurückgegangen sind, dass alle mit Abschluss und Eignung gerne übernehmen werden können.
Gleichzeitig wird man betonen müssen: In den Teams kommen verschiedene Professionen zusammen, für und im Pfarrberuf kommen mehr und mehr Quereinsteigende dazu, Prädikantinnen und Prädikanten werden neben- und hauptamtlich angestellt und Pfarrstellen innehaben (siehe Sachsen). Es ist schon bunt und es wird noch bunter werden. Das halte ich für einen Gewinn. Menschen mit unterschiedlichen Herkünften und Berufserfahrungen werden z.B. die Verkündigung vielfältiger werden lassen. Diese Vielfalt bedeutet für mich keine Herabsetzung des Pfarrberufs oder des Theologiestudiums, wohl aber eine Stärkung anderer Professionen und von Quereinstiegen. Was aber auch weiter gebraucht werden wird, sind Personen, die in einem Theologiestudium viel Zeit mit Schrift und Bekenntnistradition, Dogmatik und Religionswissenschaft, Gesellschaft und Transformation verbracht haben. Das ist für die Gespräche im Inneren und das Wirken von Kirche unverzichtbar. Aus meiner Sicht in die Irre führt aber das Festhalten am Beamtenstatus, denn dieser wird in den bald überall vorhandenen Teams eine Unwucht zementieren. Stattdessen sollten alle auf der Basis sehr ähnlicher Rechtsverhältnisse, das heißt für mich als Angestellte tätig werden. In den Teams übrigens darf die Leitung gerne wechseln, auch und gerade zwischen den dort vertretenen Professionen. Ohne Leitung wird es in den Teams aber nicht gehen (die natürlich in ihren Aufgaben zu beschreiben ist und deren Beschreibungen von Ort zu Ort auch unterschiedlich ausfallen können).
Das Festhalten am Beamtenstatus wird in den bald überall vorhandenen Teams eine Unwucht zementieren.
Aus meiner Sicht in die Irre führt auch das Festschreiben des Pfarrberufs als besonderes Leitungsamt in der Kirche. Überzeugungskraft sollte gewonnen werden durch den alten Grundsatz „sine vi, sed verbo“, also allein durch die Kraft des Wortes, der theologischen, geistlichen Kompetenz.
- Ich halte deswegen das „Kirchengemeindeleitungserprobungsgesetz“ (KGLEG) der westfälischen Kirche für einen Schritt in die richtige Richtung. Im Grundsatz kann die Kirchengemeinde dort entscheiden, das bisherige Presbyterium durch eine „Gemeindeleitung“ zu ersetzen, dem z.B. keine Pfarrperson mehr angehören muss9 . Auch wenn die Resonanz auf dieses Erprobungsgesetz bisher sehr verhalten ist, wird sich das noch sehr ändern können.
- Genauso halte ich es für denkbar, dass Tobias von Boehns Beispiel von „Gemeinde ohne leitende Pfarrperson“ an mehreren Orten Schule macht10 .
- Es gibt Gemeinschaften vor Ort, die das Kirchengebäude vor Ort rein ehrenamtlich erhalten bzw. wieder zum Leben erwecken und „bespielen“ und das wird mehr werden.
- Es gibt ausstrahlende Orte (Thomaskirche, Leipzig, Frauenkirche, Dresden), in denen neue Rechtsformen von Gemeinde mit einem Höchstmaß an Selbständigkeit und an Managementkompetenz ermöglicht werden (sollten).
- Die digitale Welt wird noch ganz andere Ausprägungen von Gemeinde und Kirche hervorbringen.
Kirchenleitung muss Macht abgeben
All dies sind Entwicklungen, die auch bei einer Fortschreibung des Pfarrberufs zu berücksichtigen sind. Meiner Meinung nach spricht all dies dafür, auch hier auf zentrale Steuerung weitgehend zu verzichten und vielmehr ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität vor Ort zu ermöglichen. Das verlangt Kirchenleitungen und Kirchenverwaltungen alles ab, vor allem die Abgabe von (vermeintlicher) Macht. Das Leben von Kirche, das Mitgestalten in einer Kirche der Menschen wird davon aber profitieren. Das alles sind für mich wichtige Bausteine einer Transformation by Design, die den Menschen, allen Mitwirkenden, an allen Orten der Kirche viel anvertraut und eben auch viel zutraut.
1. Mit riesigen Herausforderungen gerade für diese Landeskirche. Das Denken und Handeln in Regionen, die Zusammenarbeit in Teams und zwischen Gemeinden braucht jetzt ganz starke Unterstützung; siehe LU IX, Seite 22ff.
2. Vergl: Steffen Bauer: Veränderungen gestalten. Kirche systemisch wahrnehmen, 2. Auflage 2015, Kamen, Seite 46ff. Das Buch kann hier als PDF am Ende der Seite heruntergeladen werden: Ermöglichungskultur in der Kirche | Steffen Bauer
3. Die von mir wahrgenommenen Erfolgsfaktoren sind hier als PDF aufrufbar: Landeskirchen unterwegs
4. Vergl. Steffen Bauer: Kirche der Menschen zuversichtlich, mutig, beidhändig ermöglichen, 2. Auflage 2022, Oer-Erkenschwick und LU VIII, Seite 35f
5. In zwei Beratungsprozessen in Regionen der Pfalz und der EKKW erlebe ich gerade, wie traurig es ist, wenn im Blick auf die nächste Kirchenvorstands- bzw. Presbyteriumswahl in einigen Kirchengemeinden keine Kandidierenden mehr gefunden werden und somit die Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht mehr eigenständig weiterleben kann. Auch die Verrenkungen, die an vielen Orten angestellt werden, um „irgendwie“ die Liste mit Kandidierenden noch voll zu bekommen, sind eher Zeichen des Endes dieser kleinteilig-flächendeckenden Struktur in nach wie vor über 10.000 Kirchengemeinden des öffentlichen Rechts insgesamt.
7. Es scheint verstanden zu sein, dass nicht alle Landeskirchen mehr alles anbieten und vorhalten müssen und dass Einrichtungen EKD weit abgestimmt erhalten werden müssen, aber die Vielzahl eben auch verringert werden muss. Es ist gut, wenn die einzelnen Bereiche Vorschläge erarbeiten. Aber genauso wichtig ist, dass die Landeskirchen die Einzelbereiche vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Zielbildes angehen bzw. begleiten.
8. Ganz frisch gibt es die Darstellung und Auswertung mit klugen Kommentierungen zu „Befragung Nachwuchs Nordkirche zu Gründen für und gegen den Pfarrberuf“ – unbedingt lesenswert: Vikariat Nordkirche | Predigerseminar | Studierendebegleitung
9. Landessynode beschließt ‚KGLEG‘ :: Evangelisch in Westfalen – EKvW
10. Gemeinde ohne leitende Pfarrperson – BASECAMP
Titelfoto von Josh Marshall auf Unsplash
AUTORIN · AUTOR

Dr. Steffen Bauer war Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelische Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN). Er ist Autor des Buches „Kirche der Menschen – zuversichtlich, mutig, beidhändig ermöglichen“ (Verlag Hartmut Spenner).
3E ist Basecamp zum Anfassen
Du hättest eines der Dossiers gerne im Printformat, du willst einen Stoß Magazine zum Auslegen in der Kirche oder zum Gespräch mit dem Kirchenvorstand? Dann bestell dir die entsprechenden Exemplare zum günstigen Mengenpreis!